Unsere Studiengänge
BA Kommunikationswirtschaft
Im Bachelor-Studiengang Kommunikationswirtschaft bilden wir Kommunikations-GeneralistInnen aus. Unsere AbsolventInnen sind startklar für den Job – ihr Know-how geht weit über reines Disziplinendenken in Werbung, Public Relations, Marke, Corporate Identity oder Marketing hinaus.
BA Corporate Communication
The program provides a broad introduction to individual and mass media communication. Further relevant disciplines of communication (public relations, advertising, marketing, event communication, corporate identity, etc.) as well as business and legal principles are taught.
MA Kommunikationsmanagement
Im berufsbegleitenden Master-Studium bilden wir die Kommunikationsprofis der Zukunft aus. Unsere AbsolventInnen sind dort gefragt, wo eine ganzheitliche, strategische Sicht auf Kommunikationsprobleme und -lösungen vor reinem Spezialistentum gefragt ist.
Praxisprojekte mit Unternehmen
Hier finden Sie eine Auswahl von Lehrveranstaltungs-Praxisprojekten aller Studiengänge des Studienbereichs Communication Management.
Bachelor-Studiengang Kommunikationswirtschaft/Corporate Communication
| Studiengang | BA Corporate Communication |
| Auftraggeber | AGRANA |
 Unsere Studierenden des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication standen vor der herausfordernden Aufgabe, eine internationale Expansionskampagne im Speiseeis-Sektor zu entwickeln.
Unsere Studierenden des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication standen vor der herausfordernden Aufgabe, eine internationale Expansionskampagne im Speiseeis-Sektor zu entwickeln.
Im Wintersemester 2022/23 hatten die Studierenden des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication (3. Semester) die herausfordernde Aufgabe, eine B2B-Kampagne für den Relaunch des Eisgeschäfts in den USA zu entwickeln. Die Zielgruppe Business Partners sowie das Verständnis der Branche in den USA erforderte dabei einige Recherchen.
Kampagnenkonzeption wie im richtigen Berufsleben
Für ein realitätsgetreues Setting stellte AGRANA den Studierenden Interviews zur Verfügung, die zuvor mit US-amerikanischen Unternehmen der Lebensmittelindustrie geführt wurden. Auf dieser Basis erstellten die Teams faktenbasierte und erkenntnisgetriebene Marketingkampagnen zur Steigerung der Bekanntheit des AGRANA-Eissortiments unter den US-amerikanischen Produktmanager:innen. Die Konzeption umfasste eine SWOT- und PESTEL-Analyse, die Erstellung einer Persona, die das Zielpublikum am besten widerspiegelt, sowie die Entwicklung eines Kampagnenkonzepts mit Kernbotschaft und Taktik. Der gesamte Prozess wurde mit laufenden Coachings durch das Lehrendenteam Gerhard Fenkart-Fröschl, Bettina Gneisz-Al-Ani, Dieter Puganigg und Kirstie Riedl begleitet:
„Es war ein harter erster Monat, aber die Studierenden haben durchgehalten und sich wirklich mit der Aufgabe auseinandergesetzt“, kommentierte Kirstie Riedl, Academic Expert & Lecturer und Coach.
Pitch um das beste Konzept
Im Dezember 2022 präsentierten die Teams ihre Ideen für ein interaktives Eiscreme-Kreationstool auf der AGRANA-Website, Werbebroschüren mit Augmented-Reality-Funktionen, interaktive Social-Media-Kampagnen und innovative Messestände in einem Pitch vor den Auftraggeber:innen.
„You nailed it!“ lobte Auftraggeberin Gabriele Schöngruber, Digital Marketing & Sales Transformation Manager der AGRANA Group, die Studierenden nach den erfolgreichen Abschlusspräsentationen und fasste das Projekt so zusammen:
„Für das Praxisprojekt haben die Studierenden all ihre Energie und Wissen gebündelt und in ihre Arbeit einfließen lassen. Die Abschlusspräsentationen waren professionell, durchdacht und kreativ. Einige der präsentierten Ergebnisse werden wir jedenfalls in unsere Aktivitäten einfließen lassen können. Ich hoffe, die Zusammenarbeit hat den jungen Leuten genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich wünsche ihnen auf diesem Weg viel Erfolg für die restliche Zeit des Studiums!“
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | IP Österreich |
 Im Praxisprojekt mit IP Österreich entwickelten die berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft der FHWien der WKW Konzepte für eine Employer-Branding-Kampagne.
Im Praxisprojekt mit IP Österreich entwickelten die berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft der FHWien der WKW Konzepte für eine Employer-Branding-Kampagne.
„Unglaublich, so viele kreative Ideen“, kommentierte Auftraggeberin Marion Hammerl. Die Leiterin Finanz & HR des RTL-Vermarkters IP Österreich war sichtlich beeindruckt und möchte einige davon umsetzen. Eine Employer-Branding-Kampagne zur Akquise neuer Talente war das Ziel des Praxisprojekts mit Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft.
Der erfolgreiche Abschluss des Praxisprojekts wurde bei einem gemeinsamen Get-Together in der Unternehmenszentrale gebührend gefeiert. „Die Live-Präsentation bei der IP mit professionellem Feedback war die größte Lernerfahrung bisher. Die Brötchen und Getränke danach konnten wir richtig genießen“, so das Fazit der Studierenden.
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | Wien 3420 aspern Development AG |

Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft hatten die spannende Aufgabe, eine saisonalen Veranstaltungsreihe für die Seestadt zu entwickeln.
Im Auftrag der Wien 3420 aspern Development AG entwarfen die Vollzeit-Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft (3. Semester) im Wintersemester 2022/23 spannende Event-Konzepte zur Belebung der Seestadt und zur Stärkung der Seestädter Identität. Im Kick-off wurden sie von Auftraggeberin Cornelia Bredt, Marketing Managerin der Wien 3420 aspern Development AG, in der Seestadt begrüßt. Sie setzte in ihrem Briefing bereits hohe Anforderungen an die Studierendenteams. Hauptaufgabe war es, mittels einer dreijährigen Eventreihe die Identität der Seestadt zu stärken, neue Zielgruppen für den Sektor Retail und Entertainment anzuziehen und die Besucher:innenanzahl zu steigern. Diese Events sollen durch ihre Einzigartigkeit eine hohe Earned-Media-Reichweite erlangen: „Ich möchte eine Konzeption, die so einzigartig ist, dass Armin Wolf in der ZIB 2 darüber berichten würde.“
Kreativagenturen überzeugen mit Professionalität im Abschluss-Pitch
Mit dieser Herausforderung und einem großen Ziel vor Augen gingen die Studierendenteams als „Kreativagenturen“ ans Werk. Über vier Monate lang erarbeiteten sie impactstarke Veranstaltungskonzepte. Dabei setzten sie nicht nur ihr bereits erworbenes Wissen in die Praxis um, sondern erlernten wichtige Fähigkeiten für das spätere Berufsleben wie Teamfähigkeit, kreatives Denken, Projektmanagement, Storytelling und Zeitmanagement. Im dreimonatigen Kreativprozess begleiteten Lehrende aus unterschiedlichen Spezialdisziplinen die Studierenden mit Tipps aus der Praxis. Mit Unterstützung der Projekt-Coaches Ute Greutter und Martina Zöbl entstanden großartige Konzepte, die einer siebenköpfigen Jury in der Seestadt im Zuge eines Pitchs präsentiert wurden. Die Studierenden überzeugten Auftraggeberin Cornelia Bredt mit ihrer Professionalität und ihrem Einfallsreichtum:
“Ich bin überzeugt, dass es sehr wichtig ist, immer wieder mit Studierenden im Austausch zu sein, weil das die Generation ist, die die Seestadt nachhaltig prägen wird. Und genau diese Überlegungen sind für uns wichtig, damit wir einen zukunftsträchtigen Stadtteil planen können. Ich habe sechs höchst professionelle Agenturen kennengelernt, damit einhergehend auch sechs völlig unterschiedlichen Herangehensweisen. Die Konzepte haben mich absolut überzeugt. Vor allem das Engagement und die Professionalität. Davon kann sich so mancher Profi eine Scheibe abschneiden!”
Im Anschluss wurde der erfolgreiche Abschluss des Praxisprojekts bei einem gemeinsamen Abschlussessen in der Seestadt Kantine gebührend gefeiert!
| Studiengang | BA Corporate Communication |
| Auftraggeber | Procter & Gamble |
 Studierende des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication der FHWien der WKW kreierten emotionsgeladene Launch-Kampagnen für die neue elektrische Zahnbürste Oral-B iO.
Studierende des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication der FHWien der WKW kreierten emotionsgeladene Launch-Kampagnen für die neue elektrische Zahnbürste Oral-B iO.
Die Studierenden im sechsten Semester des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication hatten in ihrem zweiten Praxisprojekt die Gelegenheit, mit dem international bekannten Unternehmen Procter & Gamble zusammenzuarbeiten. Aufgabe war die Entwicklung einer Produkt-Launch-Kampagne für die neue und innovative elektrische Zahnbürste Oral-B iO.
Im ersten Schritt wurde den Studierenden eine detaillierte Fallstudie vorgelegt, die durch reale Zahlen aus der Marketing-, Vertriebs- und Finanzabteilung von Oral-B ergänzt wurde. Die sechs Teams erarbeiteten während der zweimonatigen Vorbereitungszeit ausgefeilte Kommunikationskonzepte. Ziel der Launch-Kampagne war dabei die Emotionalisierung des Produkts bei künftigen KäuferInnen. Zur großen Zufriedenheit der AuftraggeberInnen gelang es den Studierenden, diese emotionale Verbindung zwischen den VerbraucherInnen und der Zahnbürste herzustellen:
„Wir haben es sehr genossen, mit so vielen talentierten jungen Fachleuten zusammenzuarbeiten und sind erstaunt über die Konzepte, die die englischsprachige Kohorte entwickelt hat“, kommentiert Constantin Henrich, Senior Key Account Manager bei Procter & Gamble.
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | Österreichische Camping Club (ÖCC) |
 Im Praxisprojekt mit dem Österreichischen Camping Club kreierten die berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft im Sommersemester 2022 Kommunikationskonzepte zur Erschließung einer neuen Zielgruppe.
Im Praxisprojekt mit dem Österreichischen Camping Club kreierten die berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft im Sommersemester 2022 Kommunikationskonzepte zur Erschließung einer neuen Zielgruppe.
Mit über 13.000 Mitgliedern und und mehr als 30.000 LeserInnen des Fachmagazins Camping Revue ist der Österreichische Camping Club (ÖCC) die größte CamperInnen-Interessensvertretung Österreichs. War bislang die Hauptzielgruppe der österreichischen CamperInnen Personen im Alter von 50+, so erfreut sich der Campingurlaub einem immer größer werdenden Interesse unter jüngeren Personen. Mit der Aufgabe, diese neue Zielgruppe mit passenden Kampagnen und speziell über die digitalen Kanäle zu erreichen, betraute der Österreichische Camping Club (ÖCC) die berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft der FHWien der WKW. Die Studierendenteams überzeugten mit detaillierten und kanalübergreifenden Kommunikationskonzepten zur Akquise neuer Clubmitglieder, die von Analyse über Strategie, Botschaft und Maßnahmen bis zur Budgetierung reichten.
Mit einem professionellen Pitch vor den Auftraggebern ÖCC Präsident Tomas Mehlmauer und Michael Szemes, ÖCC Produktmanager, überzeugten sie durch ihr bereits fortgeschrittenes Know-how und ein hohes Ausmaß an Kreativität:
„In den vergangenen Monaten haben insgesamt fünf Teams an Kommunikationskonzepten gearbeitet. Fünf Teams, fünf verschiedene Konzepte, wie die gewünschten Ziele erreicht werden können. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und können nun aus eine Schatzkiste voller neuer Ideen schöpfen.“
Auch von Seiten der Lehrenden Martina Zöbl und Ute Greutter war die Zusammenarbeit ein voller Erfolg:
„Es ist für uns sehr beeindruckend, wie professionell die einzelnen Teams vorgegangen sind. Besser kann man die Praxis nicht lernen als bei einem Praxisprojekt!“
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | NASHA |
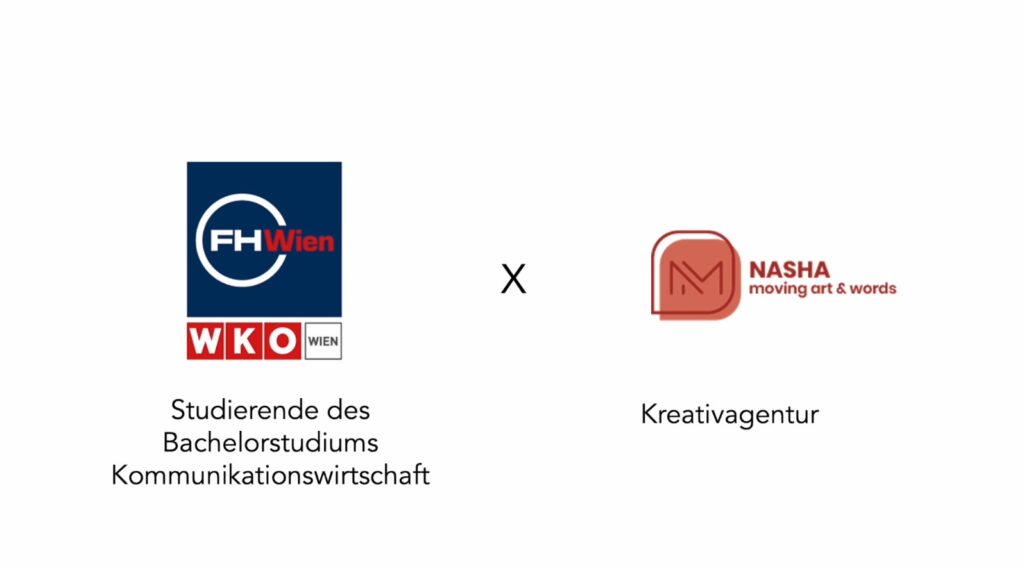 Die Vollzeit-Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft standen vor der spannenden Aufgabe, im dynamischen Wettbewerbsumfeld der Videoproduktion einen herausstechenden USP für die Kreativagentur NASHA zu entwickeln.
Die Vollzeit-Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft standen vor der spannenden Aufgabe, im dynamischen Wettbewerbsumfeld der Videoproduktion einen herausstechenden USP für die Kreativagentur NASHA zu entwickeln.
Im Sommersemester 2022 wurden die Vollzeit-Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft mit der Aufgabe betraut, NASHA zu den führenden Agenturen in visueller Kommunikation im DACH-Raum zu machen. Neben der Entwicklung eines klar herausstechenden USPs am Markt sollten auch mehrere Großkunden an Land gezogen werden. Eine besondere Herausforderung bestand im dynamischen Wettbewerbsumfeld, das aus vielen unterschiedlichen MitbewerberInnen besteht. Auch mussten die Studierenden glaubhaft argumentieren, wie sie die von der Auftraggeberin klar definierten Umsatzziele mit ihren Kommunikationskonzepten erreichen können.
Mit einem professionellen Pitch und überragenden Präsentationen vor Auftraggeberin Natascha Machsteiner, Gründerin & Inhaberin von NASHA, überzeugten die Studierenden durch Umsetzungskraft und Ideenreichtum:
„Uns war der Blick von außen sehr wichtig, da man selbst für eigene Themen gerne den Scheuklappenblick bekommt. Die Abschlusspräsentationen waren sehr spannend, da die Studierenden in jungen, frischen Dimensionen denken. Vieles hat uns bestärkt, es war aber definitiv auch ein „Wow“-Effekt dabei. Wir werden sicherlich einiges umsetzen können. Ich war wirklich beeindruckt!“
Auch für Projektcoach und Studiengangsleiter David Dobrowsky war die Zusammenarbeit ein voller Erfolg:
„Das Praxisprojekt zielt darauf ab, dass die im Studium erlernten theoretischen Inhalte in einem realen Auftrag in die Praxis umgesetzt werden. Die Studierenden lernen ein Briefing zu verstehen und so umzusetzen, dass die Erwartungen der AuftraggeberInnen erfüllt werden. Die Studierenden haben diese herausfordernde Aufgabe sehr gut gelöst!“
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | CliniClowns |
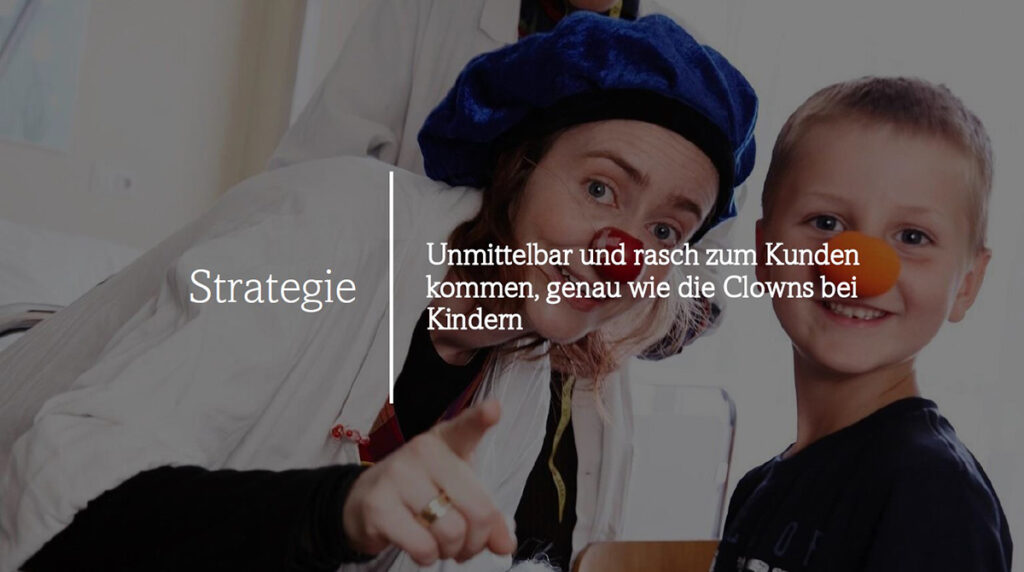 Im Praxisprojekt mit CliniClowns entwarfen die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft aussagekräftige Kampagnen zur Akquisition neuer SponsorInnen.
Im Praxisprojekt mit CliniClowns entwarfen die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft aussagekräftige Kampagnen zur Akquisition neuer SponsorInnen.
Der gemeinnützige Verein CliniClowns stützt sich auf Personen, die etwas Freude und Fröhlichkeit in den Spitalsaufenthalt schwerkranker Kinder und Erwachsener bringen wollen. Diese umfassen nicht nur die Mitglieder des Vereins selbst, sondern auch diejenigen, die einen finanziellen Beitrag leisten wollen. Die Finanzierung durch Spenden und Sponsoring ist daher eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Lachtherapie vor Ort. Zu diesem Zweck beauftragten die CliniClowns ein Studierendenteam des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft mit der Entwicklung eines impactstarken Kommunikationskonzepts zur Akquise neuer SponsorInnen in ihrem ersten Praxisprojekt.
Sponsoring mit positiven Nebenwirkungen
Mit klar definierten Zielen für Spendenvolumen, Reichweite und Interaktionsrate startete das Team „Zukunftsgestalter“ in sein erstes Praxisprojekt im Wintersemester 2021/22. Ausgehend von einer kreativen Leitidee gemäß dem Motto: „unmittelbar und mit sofortiger positiver Wirkung“ entwickelten sie eine umfassende Kommunikationsstrategie, die sowohl Großunternehmen als auch kleinere Unternehmen und Start-ups ansprechen soll. Das Team überzeugte mit einem detaillierten Maßnahmenplan für Brand Awareness und Akquisition, der vom Aufbau eines Social-Media-Profils über Automatisierungsprozesse bis hin zur Erfolgskontrolle reichte.
Elisabeth Ort, Generalsekretärin bei CliniClowns, war von den Resultaten begeistert:
„Es hat mich sehr gefreut, dass sich die Studierenden so intensiv mit den CliniClowns auseinandergesetzt haben. Man merkt, dass sie sehr viel Gehirnschmalz hineingesteckt haben. Die klare Herausarbeitung der Zielgruppen, einer wesentlichen Kernbotschaft und Strategie gefällt mir sehr gut. Wir werden die Ideen in adaptierter Form sicherlich umsetzen!“
Auch Projektcoach Martina Zöbl ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden:
„Die Studierenden sind immerhin erst im 3. Semester und werden mit dem ersten Praxisprojekt direkt ins kalte Wasser gestürzt. Sie haben diese Herausforderung hervorragend gemeistert. Durch ihr bereits erworbenes Fachwissen und Learning by Doing haben sie schon Anfang ihres zweiten Studienjahres gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt!“
Die Studierenden haben ihre Eindrücke über das erfolgreich abgeschlossene erste Praxisprojekt in diesem Video zusammengefasst:
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | Ottakringer Brauerei |

Die Marke Ottakringer bei einer jungen Zielgruppe attraktiver zu machen, war die Aufgabe der berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft im Praxisprojekt mit der Wiener Traditionsbrauerei aus dem 16. Bezirk.
Unter dem Motto „Von der Zielgruppe für die Zielgruppe“ entwickelten die berufsbegleitend Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft (3. Semester) der FHWien der WKW kreative Leitkonzepte, um das Biersortiment der Ottakringer Brauerei bekannter und attraktiver zu machen. Mit hoher Motivation starteten die Studierenden im Wintersemester 2021/22 in ihr erstes Praxisprojekt. Zum Auftakt luden die AuftraggeberInnen zur Besichtigung der Brauerei inklusive Verkostung ein. Darauf folgte das Detailbriefing. Sechs Gruppen, die als eigene Kreativagenturen auftraten, bewiesen sich in Projektmanagement bis hin zu Creative Thinking und erarbeiteten unterschiedliche kreative Leitideen. In die gezielte Analyse der Zielgruppenbedürfnisse flossen die Ergebnisse der eigenen Marktforschung genauso ein wie eigene Ansichten, da die Studierenden gleichzeitig auch die AdressatInnen der Kommunikationskonzepte waren. Darauf basierend lieferten sie konkrete Kampagnenentwürfe, die sowohl inhaltlich als auch in kreativer Sicht das bereits breite fachliche Know-how in Marketing und Kommunikation unter Beweis stellten.
Neue Impulse für die Ottakringer Brauerei
Die Abschlusspräsentationen zu Ende des Semesters fanden vor komplettem Führungsteam statt. Sechs neue Konzepte zur Vermarktung lieferten spannende neue Impulse für Brand Awareness und Attractiveness. Geschäftsführer Harald Mayer, Geschäftsführer und 1. Braumeister Tobias Frank, Michael Neureiter, Leitung Ottakringer BrauWerk & Ottakringer Shop sowie Senior Marketingmanagerin Brand & PR Andrea Fenzl waren von den Endergebnissen der Kooperation mit der FHWien der WKW sehr zufrieden.
Geschäftsführer Harald Mayer ist vom Engagement aller sechs Studierenden-Teams begeistert:
„Aus unserer Sicht war dieses Projekt eine großartige Win-Win-Situation. Die Studierenden haben sich intensiv mit unserer Marke beschäftigt und spannende Kommunikationskonzepte mit unterschiedlichen Zugängen ausgearbeitet und wir haben dadurch viele wertvolle, neue Ideen erhalten. Vielfalt, Offenheit und Lebensgefühl sind Kernwerte unserer Marke und decken sich auch gleichzeitig mit dem, was vielen jungen Leuten wichtig ist. Dass uns die Studierenden ‚verstanden‘ und das richtige Gespür für die Marke Ottakringer entwickelt haben, freut uns besonders.“
Auch die Projektcoaches Tilia Stingl de Vasconcelos Guedes und Ute Greutter sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden:
„Dieses Praxisprojekt hat gut gezeigt, was dabei herauskommt, wenn eine engagierte, kreative Gruppe junger Menschen und ein innovationsbereites Unternehmen ein gemeinsames Ziel haben: Es entstehen originelle, umsetzungsbereite und – besonders in diesem Fall – zielgruppenansprechende Kommunikationskonzepte!“
Die Studierenden haben ihre Eindrücke über das erfolgreich abgeschlossene erste Praxisprojekt in diesem Video zusammengefasst:
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | Almdudler |
 Im Praxisprojekt mit Almdudler entwickelten die Vollzeit-Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft integrierte Marketingkonzepte für die Variante zuckerfrei.
Im Praxisprojekt mit Almdudler entwickelten die Vollzeit-Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft integrierte Marketingkonzepte für die Variante zuckerfrei.
„Almdudler Zuckerfrei macht das Leben schöner!“ – unter diesem Motto entwickelten die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft (3. Semester) Marketingkonzepte im Praxisprojekt mit Almdudler mit dem Ziel, die zuckerfreie Sorte der Alpenkräuterlimonade in der Gastronomie bekannter zu machen.
Was zu Beginn des Wintersemester 2021/22 eine große Herausforderung für die Studierenden war und einem Sprung ins kalte Wasser glich, führte zu großartigen Resultaten. Fünf Gruppen erhielten dasselbe Briefing und arbeiteten innerhalb von vier Monaten unterschiedliche Konzepte zur Steigerung der Brand Awareness aus. Jedes Team setze dabei seinen eigenen Fokus und überzeugte mit gekonnter Zielgruppenanalyse, Strategieentwicklung und Ableitung von aufeinander abgestimmten On- und Offline-Marketingmaßnahmen sowie einer ordentlichen Portion Kreativität und Ideenreichtum.
Valerie Semorad, Teamleitung Brandmanagement bei Almdudler, war mit den Ergebnissen sehr zufrieden:
„Wir durften über das ganze Semester das Projekt wachsen sehen. Wie sich die Studierenden weiterentwickelt haben, war erstaunlich. Man hat allen die Freude angemerkt, das Gelernte in die Praxis umzusetzen – noch dazu mit Almdudler. Die facettenreichen Endpräsentationen haben mir äußerst gut gefallen. Durch den Blick von außen haben wir viele neue Einblicke gewinnen können!“
Auch Projektcoach Martina Zöbl ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden:
„Es geht in einem Praxisprojekt immer um „Learning by Doing“. Die Bachelor-Studierenden werden im 3. Semester daher ins kalte Wasser geschupst. Bei gleicher Aufgabenstellung die unterschiedlichen Lösungsansätze zu sehen, war sehr spannend. Ich bin sehr zufrieden mit dem Outcome!“
Die Studierenden haben ihre Eindrücke vom Praxisprojekt in diesem Video zusammengefasst:
| Studiengang | BA Corporate Communication |
| Auftraggeber | Catholic Relief Service (CRS) |
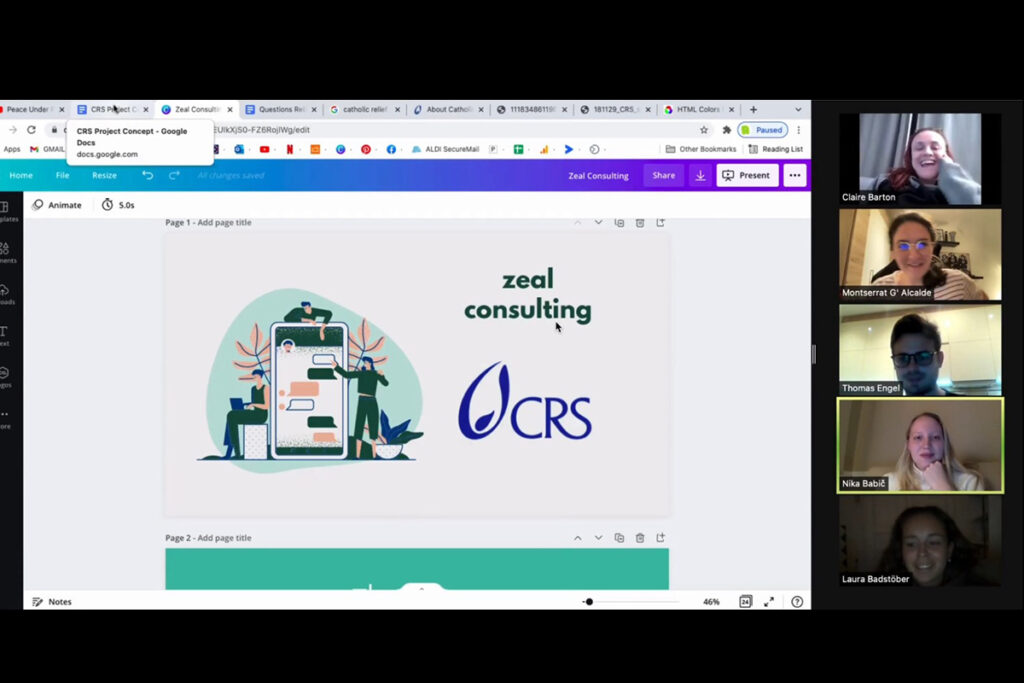
Für einen internationalen Kunden entwarf ein Studierendenteam des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication eine innovative Kampagne zur Optimierung der internen Kommunikation in einer Non-Profit-Organisation.
Von September bis Dezember 2021 arbeiteten die Bachelor-Studierenden der englischsprachigen Kohorte des Bachelor-Studiengangs Corporate Communication (3. Semester) an ihrem ersten, anspruchsvollen Praxisprojekt. Sie überzeugten die AuftraggeberInnen mit ihren außergewöhnlichen und einzigartigen Ideen und einer komplett durchdachten, auf die Bedürfnisse der KundenInnen abgestimmten Kampagnenstrategie.
Optimierung der internen Kommunikation für ein sensibles Thema
Catholic Relief Service (CRS) ist eine Mitgliedsorganisation von Caritas international mit Hauptsitz in Baltimore, USA, die in Entwicklungsländern tätig ist. Die MitarbeiterInnen der CRS-Abteilung für Sicherheit und Gefahrenabwehr (Security and Safety Department, SSD) sind oft mit entsetzlichen Bedingungen konfrontiert, die sogar das Leben bedrohen. Daher sind Nachrichten aus dieser Abteilung oft negativ besetzt und wenig wertgeschätzt. Im Zuge des Praxisprojekts bestand die Aufgabe der Studierenden darin, eine interne informative Kommunikationskampagne für mehr gegenseitiges Verständnis zu kreieren. Unter dem Slogan „VALYOU – We Value You“ entwickelte das Studierendenteam „Zeal consulting“ ein emotional berührendes und innovatives internes Kommunikationskonzept, um Einstellungen positiv zu verändern. Mittels Storytelling in Kombination mit einem Informationssystem werden MitarbeiterInnen des SSD als auch KollegInnen anderer Abteilungen angesprochen, um die Beziehungen innerhalb CRS zu stärken.
Großes Lob seitens der AuftraggeberInnen
Die Gruppe schloss das Projekt mit ihre Präsentation Mitte Dezember 2021 ab, bei der sie ihre Ideen der gesamten Kohorte, dem Lehrendenteam sowie auch den tief beeindruckten AuftraggeberInnen von CRS vorstellte:
„Wir sind sehr überwältigt davon, wie gut diese Präsentation sowohl aus der Sicht des Marketings und der Kommunikation als auch in Bezug auf unsere Organisation, unsere Bedürfnisse und unsere Beweggründe ausgearbeitet wurde. Es war wirklich beeindruckend und unglaublich professionell!“ (übersetzt aus dem Englischen)
Coach und Lehrende Kirstie Riedl fasste das Praxisprojekt mit diesen lobenden Worten zusammen:
„Obwohl es eine sehr schwierige Aufgabe war, haben sich die Studierenden mächtig ins Zeug gelegt. Die Kampagne war so gut durchdacht. Ich bin wirklich stolz auf unsere Studierenden!“ (übersetzt aus dem Englischen)
| Studiengang | BA Corporate Communication |
| Auftraggeber | WIEN MITTE The Mall |
 Die COVID-19-Pandemie hat ihre Spuren im stationären Handel hinterlassen. Deshalb beauftragte WIEN MITTE The Mall die englischsprachige Kohorte des Bachelor-Studiengangs Corporate Communication mit der Entwicklung innovativer Aktivierungskampagnen.
Die COVID-19-Pandemie hat ihre Spuren im stationären Handel hinterlassen. Deshalb beauftragte WIEN MITTE The Mall die englischsprachige Kohorte des Bachelor-Studiengangs Corporate Communication mit der Entwicklung innovativer Aktivierungskampagnen.
Unter anspruchsvollen Bedingungen stellten sich im Wintersemester 2021/22 fünf Studierendenteams des englischsprachigen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication (3. Semester) ihrem ersten Praxisprojekt. Trotz COVID-19 bedingten Einschränkungen gelang es ihnen, vor Ort Marktstudien durchzuführen und die AuftraggeberInnen mit durchdachten Kommunikationskampagnen zu überzeugen. Ziel war es, die KundInnenfrequenz bei „WIEN MITTE The Mall“, einem beliebten Einkaufszentrum im Zentrum Wiens, zu steigern.
Strategie und Umsetzung auf hohem Niveau
Nach dem Briefing begannen die Studierendenteams „Changency“, „Lighthousemarketing“, „Refresh“, „Sixhead“ und „Vlaamm“ mit einer detaillierten Analyse der aktuellen Situation. Sie führten eine „Desktop-Recherche“ und SWOT-Analyse sowie auch eine Umfrage vor Ort durch. Auf dieser Basis erarbeiteten sie unter Einsatz ihres gesamten bisher erworbenen Fachwissens durchdachte Kommunikationsstrategien. Passende Personas wurden ebenso erstellt wie Customer Journeys, die Social-Media-Kampagnen mit OOH-Werbung verknüpften, um die BesucherInnenzahlen zu steigern. Darüber hinaus bewiesen sie enorme Kreativität: Als Agenturen erarbeiteten sie realitätsnahe Previews ihrer vorgeschlagenen Werbesugets und bewiesen ihre Kompetenz im Umgang mit Grafikprogrammen und digitalen Tools.
Der Pitch: Beeindruckende Abschlusspräsentationen begeistern AuftraggeberInnen
In einem abschließenden Pitch zeigten die Studierenden ihre Professionalität in durchdachten Präsentationen. Mit ihren innovativen und eindrucksvollen Kommunikationskampagnen haben sie das Ziel, nämlich Frequenzerhöhung und NeukundInnengewinnung, definitiv erreicht. WIEN MITTE The Malls Immobilienmanager Florian Richter fand nach den Abschlusspräsentationen folgende lobende Worte:
„Ich freue mich über die Entscheidung, dieses Semester mit der FHWien der WKW zusammenzuarbeiten. Es war toll zu sehen, was sich die einzelnen Gruppen ausgedacht haben und die Präsentationen waren sehr fortschrittlich. Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss, welche Gruppe die beste war, denn das wäre fast unmöglich. Alle haben eine tolle und kreative Arbeit geleistet!“
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | WEMOVE RUNNING STORE |
 Junge KundInnen für das Laufen als gesunde Freizeitbeschäftigung zu begeistern und diese in den Laufshop zu holen, war das Ziel der Bachelor-Studierenden der berufsbegleitenden Kohorte des Studiengangs Kommunikationswirtschaft im Praxisprojekt mit WEMOVE RUNNING STORE.
Junge KundInnen für das Laufen als gesunde Freizeitbeschäftigung zu begeistern und diese in den Laufshop zu holen, war das Ziel der Bachelor-Studierenden der berufsbegleitenden Kohorte des Studiengangs Kommunikationswirtschaft im Praxisprojekt mit WEMOVE RUNNING STORE.
Der WEMOVE RUNNING STORE im Einkaufszentrum „Wien Mitte – The Mall“ ist unter gesundheitsbewussten LäuferInnen mittleren Alters bestens bekannt. Das Laufen soll nun auch eine jüngere Zielgruppe der Generation Y & Z erreichen, jedoch nicht als reine Sportaktivität, sondern auch als freies, kostenloses und vor allem gesundes Hobby. Projektauftraggeber Michael Wernbacher, Inhaber und Geschäftsführer der WEMOVE GmbH, beauftragte die berufsbegleitende Kohorte des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft der FHWien der WKW daher im Sommersemester 2021, Awareness-Kampagnen für eine junge Zielgruppe zu kreieren und gleichzeitig die gewonnenen Laufinteressierten in den Laufshop zu holen.
Instagram und TikTok erreichen Generation Y und Z
Mit klarem Fokus auf Social Media entwarfen die Studierenden durchdachtes Text- und Bildmaterial sowie Kurzvideos, wobei besonders mit den zielgruppenrelevanten Plattformen Instagram und TikTok gearbeitet wurde. Auftraggeber Michael Wernbacher zeigte sich von den variantenreichen Ideen der Teams überwältigt: „Der Outcome des Praxisprojekts ist aus meiner Sicht richtig, richtig fantastisch. Für die Zukunft werden wir das Beste aus allen Konzepten für WEMOVE einsetzen, da jedes der präsentierten Konzepte mindestens eine besonders herausragende Maßnahme vorzuweisen hatte.“ Als Dankeschön durften sich die Studierenden ihr eigenes Paar (Lauf-)Schuhe direkt im Wiener Store abholen.
Das Praxisprojekt als beste Vorbereitung für den Job
Trotz der außergewöhnlichen Arbeitsumstände in der Distance-Lehrsituation stellten die Bachelor-Studierenden ihre Kreativität, ihr Know-how und ihre Flexibilität unter praxisnahen Umständen unter Beweis. Coach und Lektor Manfred Gansterer erklärt: „Die Studierenden profitieren auf mehreren Ebenen: inhaltlich und prozesstechnisch. Es ist ein realistischer Ablauf.“ Academic Coordinator und Coach Martina Zöbl ergänzt: „Unsere Alumni bestätigen mir immer wieder: Das Praxisprojekt war das Modul, das sie am meisten und besten für die Praxis vorbereitet hat.“
Auch der UnternehmerInnengeist wurde unter einigen Studierenden geweckt. So gründete ein Studierenden-Team bereits eine eigene Agentur, um die Ideen für WEMOVE in die Tat umzusetzen. Mit Spannung können auch Sie die Entwicklungen mitverfolgen, z.B. auf Facebook oder Instagram!
| Studiengang | BA Corporate Communication |
| Auftraggeber | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
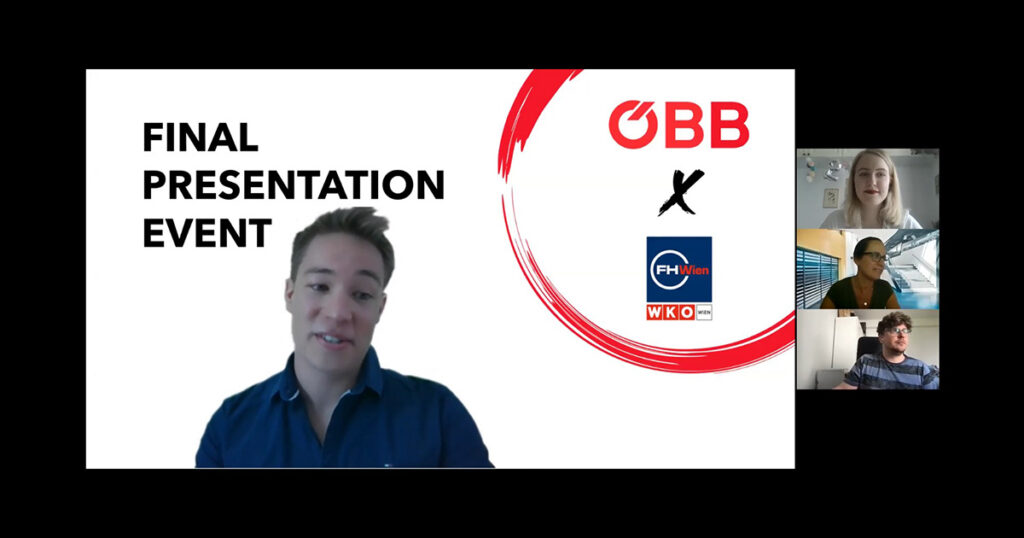 Wie TikTok, Spotify oder Clubhouse für eine effektive und professionelle Unternehmenskommunikation genutzt werden können, bewiesen die Bachelor-Studierenden des englischen Studiengangs Corporate Communication im Praxisprojekt mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).
Wie TikTok, Spotify oder Clubhouse für eine effektive und professionelle Unternehmenskommunikation genutzt werden können, bewiesen die Bachelor-Studierenden des englischen Studiengangs Corporate Communication im Praxisprojekt mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).
Unterhaltsame Videos auf TikTok, Musik-Streaming via Spotify und Interviews über die Apple-Clubhouse-App eröffnen vor allem einer jungen Zielgruppe den Blick in die Welt. Die für Zwecke der Unternehmenskommunikation noch wenig erprobten Kanäle bieten für Firmen sowohl Chancen als auch Risiken. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nahmen dies zum Anlass, die Plattformen im Praxisprojekt mit der FHWien der WKW durch Studierende des englischen Bachelor-Studiengangs Corporate Communication (6. Semester) gründlich analysieren zu lassen. Diese entwarfen nach einer fundierten SWOT-Analyse maßgeschneiderte Personas, kreierten treffsicheren Content pro Kanal und überzeugten die AuftraggeberInnen mit umfassenden Kommunikationskonzepten von der Strategie bis hin zur kreativen Umsetzung mit Timing und Budgetplan.
Umdenken in neuen Kanälen – zwischen leger und elitär
So unterschiedlich TikTok, Spotify und Clubhouse sind, so differenziert muss auch das Werbeformat sein. Mit Fingerspitzengefühl kreierten die Studierenden in professionellem „Agenturstil“ Content-Pläne mit kreativen Ideen für die Umsetzung mittels passgenauer und authentischer Video-/Audio- und Bilderwelten und optimaler Botschaften – von leger für TikTok bis hin zu elitär für Clubhouse. Dazu erklärte eine Detailanalyse die Mechanismen der jeweiligen Kanäle bis hin zum Algorithmus, der sich hinter jeder Plattform verbirgt. Infotainment war das Stichwort für eine perfekte Balance zwischen Werbebotschaft und unterhaltsamen Content, ganz im Sinne von „entertain – explain – inspire“.
Probieren geht über studieren
Für die Endpräsentation Mitte Mai 2021 entwickelte jedes Studierenden-Team sein eigenes Agentur-Corporate-Design. Im Pitch traten dann „Adtempus“, „Branding Ovation“, „Futuremind“, „Goldig“, „Ideenwerkstatt“ and „Smoking Brains“ gegeneinander an und überzeugten mit starker Performance.
Die Begeisterung der AuftraggeberInnen war entsprechend groß: „Wir schätzen die Zusammenarbeit in den Praxisprojekten der FHWien der WKW sehr. Auch diesmal haben die Studierenden wieder profunde Analysearbeit geleistet und einige neue Denk-Ansätze geliefert, die wir uns nun näher ansehen werden“, unterstreicht Robert Lechner, Leiter Konzernkommunikation ÖBB-Holding AG.
Auch Academic Coordinator und Coach Kirstie Riedl ist vollen Lobes: „Unglaublich, mit wie viel Elan die Studierenden auch trotz dem Online-Setting an das Projekt herangegangen sind. Die Ergebnisse können sich sehen lassen!“ Somit wäre nur noch eines zu sagen: Die Kanäle sind studiert – jetzt wird probiert!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | Jugend am Werk |
 Die Intensivausbildung für Frauen in der Kfz-Technik attraktiver machen – vor dieser Aufgabe standen Vollzeitstudierende des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft in ihrem Praxisprojekt. Die innovativen Kommunikationskonzepte begeisterten den Auftraggeber Jugend am Werk.
Die Intensivausbildung für Frauen in der Kfz-Technik attraktiver machen – vor dieser Aufgabe standen Vollzeitstudierende des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft in ihrem Praxisprojekt. Die innovativen Kommunikationskonzepte begeisterten den Auftraggeber Jugend am Werk.
Der gemeinnützige Verein Jugend am Werk (JaW) bietet im Zuge der Maßnahme „Frauen in die Technik“ mit finanzieller Unterstützung des AMS Wien arbeitslosen Frauen ab 18 Jahren mit Pflichtschulabschluss die Möglichkeit, eine Intensivausbildung zur Facharbeiterin in der Kfz-Technik zu absolvieren. Im Wintersemester 2020/21 standen die Vollzeit-Studierenden des Studiengangs Kommunikationswirtschaft der FHWien der WKW nun im Praxisprojekt mit JaW vor einer herausfordernden Aufgabe: Gefragt waren Kommunikationskonzepte, die mehr Frauen für die Intensivausbildung in der Kfz-Technik begeistern und die Bewerbungen für die Ausbildungsplätze erhöhen.
Nach erfolgtem Briefing und dem Besuch des Lehrbetriebs Technologiezentrums von Jugend am Werk standen die sechs Studierendenteams zunächst vor einer umfangreichen Recherchearbeit, darunter u.a. auch „harter“ Desktop-Research über Berufsprofil und Arbeitsmarktstatistiken.
Mittels SWOT-Analyse wurde der Status-Quo der bisherigen Werbeinhalte, sowohl online als auch offline, eruiert und Verbesserungspotenziale wurden herausgearbeitet. Eine umfassende Zielgruppenanalyse führte zu attraktiven Werbebotschaften über geeignete, zeit- und zielgruppengemäße Werbemittel und Kanäle. Die Studierenden konnten dabei ihr erworbenes Know-how umsetzen und ihrer Kreativität in Strategie und Umsetzung freien Lauf lassen. Darüber hinaus erstellten sie nicht nur punktgenaue Zeitpläne, sondern optimierten auch den Budgeteinsatz.
Sechs Teams sechs Konzepte: Aktivierung & Attraktivierung
Unter dem Motto „Frauen in die Technik“ kamen provokante und humorvolle Kommunikationskampagnen heraus. Im Fokus standen Storytelling & Social Media sowie ein „Brush-up“ der bisherigen Werbemittel. Darüber hinaus lieferten die Bachelor-Studierenden ihren AuftraggeberInnen neue Ideen für Marketingmaßnahmen auch jenseits des Mainstreams: Mittels Influencer Marketing sowie aufmerksamkeitsstarken Events im Sinne von Guerilla Marketing soll dabei die Aktivierung und Attraktivierung bei den einzelnen Zielgruppen erfolgen. Die einzelnen Teams punkteten dabei mit wirkungsvollen Slogans wie „Girls get it done“ oder „Klar, kann sie Kfz!“. Eine durchdachte Bilderwelt trug zudem zur Emotionalisierung des Themas bei.
AuftraggeberInnen voller Begeisterung
Die Begeisterung der AuftraggeberInnen nach der online stattgefundenen Abschlusspräsentation im Dezember 2020 war groß:
„Unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen, ich bin begeistert von den Ergebnissen! Es hat sich wirklich ausgezahlt, denn es sind jede Menge konkret umsetzbarer Ideen dabei“, fasst Auftraggeberin Martina Garhofer, die den Lehrbetrieb Technologiezentrum sozialpädagogisch betreut, die Konzepte zusammen.
„Ich bin mega-begeistert, die Storytelling-Videos der Studierenden haben mich total vom Hocker gehaut, manchmal auch zu Tränen gerührt. Es sind so viele tolle Ideen dabei!“, freut sich Auftraggeberin Claudia Schwarz, die ebenfalls die sozialpädagogische Betreuung des Lehrbetriebs Technologiezentrums innehat.
Auch Wolfgang Bamberg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Jugend am Werk, ist voll des Lobes über die Kreativität der Studierendenteams: „Da ist jede Menge Neues dabei. Ich bin mir sicher, dass wir viel davon für unsere weitere Arbeit einsetzen können!“
Academic Coordinator und Coach Martina Zöbl gratulierte den Studierenden ebenfalls zu diesem erfolgreichen Abschluss des Praxisprojekts: „Die besondere Herausforderung bei diesem Projekt war es, mit einer relativ geringen Budgetvorgabe eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Es war dahingehend für die einzelnen Teams eine sehr gute Übung für ihre berufliche Praxis.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
Hier finden Sie Beispiele für die kreative Umsetzung der Kampagne mittels Storytelling-Videos:
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester |
3. Semester |
| Auftraggeber | Österreichische HochschülerInnenschaft |
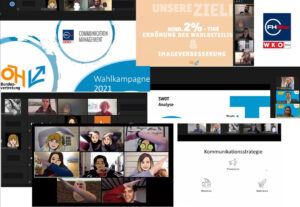 Im Zuge des Praxisprojekts entwickelten die Studierenden des berufsbegleitenden Bachelorstudiums „Kommunikationswirtschaft“ (3. Semester) impactstarke Kommunikationskonzepte für die kommende Wahlkampagne der Österreichischen Hochschüler_innenschaft.
Im Zuge des Praxisprojekts entwickelten die Studierenden des berufsbegleitenden Bachelorstudiums „Kommunikationswirtschaft“ (3. Semester) impactstarke Kommunikationskonzepte für die kommende Wahlkampagne der Österreichischen Hochschüler_innenschaft.
Österreichs Studierende haben alle zwei Jahre die Möglichkeit, ihre direkten VertreterInnen bei der Politik zu wählen: Wenn im Mai 2021 Studierende in ganz Österreich aufgerufen sind, bei der ÖH-Wahl ihre Stimme abzugeben, dann sind Studierende der FHWien der WKW diesmal nicht nur wählend beteiligt.
Von der Zielgruppe für die Zielgruppe
Im Rahmen eines Praxisprojekts haben die Studierenden des berufsbegleitenden Bachelorstudiums „Kommunikationswirtschaft“ (3. Semester) die Österreichischen Hochschüler_innenschaft für die kommende Wahlkampagne unterstützt und kreative Kommunikationskonzepte zur Steigerung der Wahlbeteiligung erarbeitet. Ein kniffliger und komplexer Auftrag, an den der Jahrgang mit Fleiß, Motivation und einer Portion Humor professionell herangegangen ist.
Im stark von COVID-19 geprägten Jahr standen die Studierenden vor zusätzlichen Herausforderungen. Zu Beginn des Wintersemesters 2020 wurde anfangs auf hybrides und später gänzlich auf Distance Learning umgestellt. Von Analyse über Strategie, Botschaft und Maßnahmen bis zur Budgetierung spielten die Studierenden in sechs Teams alle Eventualitäten durch, um besonders wirkungsvolle Lösungsansätze zu kreieren. Und das ohne persönlichen Kontakt und hauptsächlich in digitaler Zusammenarbeit.
Professionelle Online-Pitches und Möglichkeit, bei der Umsetzung mitzuarbeiten
Von Online-Kampagnen, über innovative Kanäle der Kommunikation bis zum nützlichen Wahlkit stellten alle Teams in unterschiedlichen spannenden Konzepten ihre Ideen vor, heuer im rein virtuellen Setting. Gut gelaunt und voller Tatendrang überzeugten die Studierenden ÖH-Vorsitzende Sabine Hanger und ihr Team:
„Wir freuen uns über die neuen Ideen, der frische Wind hat uns eine andere Perspektive und wertvolle Ansätze geliefert. Besonders gefallen hat uns die Vielfalt der aufgezeigten Möglichkeiten und die Hands-on-Mentalität der Studierenden.“
Es wurde ein Siegerteam gekürt, das die Möglichkeit bekommt, bei der Umsetzung der eigenen Kampagnen-Idee mitzuarbeiten.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Corporate Communication |
| Semester |
3. Semester |
| Auftraggeber | Smart City Wien |

Studierende des Bachelor-Studiengangs Corporate Communication entwickelten Konzepte für die Nachhaltigkeitskommunikation im Praxisprojekt mit Smart City Wien.
Praxiserfahrung im Kommunikationsbereich zu sammeln und dabei das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Stadt zu verbessern, in der man studiert – diese Möglichkeit erhielten die Studierenden des 3. Semesters des komplett in englischer Sprache unterrichteten Bachelor-Studiengangs Corporate Communication, als Smart City Wien ihnen als Auftraggeber für ihr Praxisprojekt vorgestellt wurde.
Die Studierenden hatten die Aufgabe zu zeigen, dass ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen und eine Verhaltensänderung notwendig, aber auch nützlich für die Umwelt und die BürgerInnen sind. Über das Semester hinweg arbeiteten die Gruppen kontinuierlich an Ideen, Designs und Konzepten. In der Folge war das Team von Smart City Wien mit den vielfältigen, gut geplanten und professionellen Kampagnen mehr als zufrieden.
Mit COVID-19 standen die Studierenden vor einigen zusätzlichen Herausforderungen und mussten auf die Abschlusspräsentation im Wiener Rathaus verzichten. Sie stellten stattdessen ihre Konzepte via Online-Konferenz vor. Dennoch waren die Präsentationen ein großer Erfolg und zeigten das hohe Niveau an Professionalität und Anpassungsfähigkeit, das die Studierenden bereits in ihren absolvierten Lehrveranstaltungen erworben haben.
Einen großen Dank an IBES und Daniela Ortiz, die das Projekt angeregt und die Studierenden mit ihrem Fachwissen in Business Ethics & Sustainable Strategy unterstützt hat, sowie an das ganze Team von Smart City Wien, das uns ihre Kampagne anvertraut hat!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Auftraggeber | C&A |

Junge Köpfe, junge Mode, junges Image. Unter diesem Motto kollaborierte das Modelabel C&A mit Studierenden der FHWien der WKW. Das Ziel: Eine Kampagne zu kreieren, die junge KundInnen in C&A-Filialen lockt.
Von Februar bis Mai dieses Jahres wurde die FHWien der WKW Mittelpunkt einer einzigartigen Kooperation zwischen Mode-Ikonen und Kampagnen-Schöpfern: Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs „Kommunikationswirtschaft“ der FHWien der WKW sollten in sechs Gruppen je eine ansprechende Kampagne für das Modelabel C&A entwickeln. Das Ziel: Junge KundInnen in die Stores zu holen. Sowohl Briefing, Coachings der Lektoren, Re-Briefing als auch Maßnahmen- und Strategie-Erarbeitung liefen so realitätsnah wie möglich ab.
Als praxisorientierte Institution verfolgt die FHWien der WKW das Ziel, die Studierenden möglichst realitätsnahe auszubilden. Mit einem Projekt dieser Größe ist dies erfolgreich gelungen: Nach Briefing, Re-Briefing und laufenden Coachings mit den Lektoren entwickelten die sechs Gruppen als „Agenturen“ je ein Kommunikations-Konzept, das sie den Vorständen des Unternehmens am 14. Mai 2019 im Rahmen einer Abschlusspräsentation vortrugen. Gustav Steininger (Head of Regional Marketing AT & CEE) sowie Markus Krenn (Regional Merchandise Planner) waren sowohl bei Briefing, Re-Briefing, Zwischenpräsentation als auch Endpräsentation anwesend. Zudem genoss die Kohorte die Präsenz von C&As Country Manager Austria, Boyko Tchakarov, der mit seinen Kollegen die Endpräsentation der Agenturen bewertete.
Content auf Agentur-Niveau, so das allgemeine Feedback. „In jeder Präsentation waren Inputs dabei, die uns zum Nachdenken angeregt haben und Ideen, die sich miteinander kombinieren lassen“, resümierte ein zufriedener Gustav Steininger. Ein erfolgreicher Tag also – sowohl für die Studierenden, die viel aus dem Projekt lernen konnten, als auch für die Auftraggeber, die mit wertvollem Wissen nachhause gingen.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 4. Semester |
| Auftraggeber | Confiserie Heindl |

Einer besonderen Aufgabe stellten sich die 35 Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft (4. Semester): Sie wurden im Praxisprojekt von der Confiserie Heindl damit beauftragt, für die Zielgruppen „Touristen“ und „Generation Y“ neue Produkte zu entwickeln und dafür eine komplette Kommunikationskampagne zu entwerfen. Und somit ließ die Familie Heindl den Studierenden ihren kreativen Ideen komplett freien Lauf.
Sechs Gruppen gaben drei Monate lang ihr Bestes, um am Ende die AuftraggeberInnen von ihrem Konzept zu überzeugen und das bisher Gelernte unter Beweis zu stellen. Und das mit vollem Erfolg! Am Montag, den 20.5.2019, fand die Abschlusspräsentation an der FHWien der WKW statt. Im Beisein der Familie Heindl lieferte jede Gruppe eine professionelle, innovative und kreative Präsentation ab. Die AuftraggeberInnen waren beeindruckt von den Produktkonzepten, die von der Rezeptur bis hin zum Packaging ins kleinste Detail durchgeplant waren. Die Vermarktungskampagnen begeisterten mit durchdachten integrierten Kommunikationsmaßnahmen an den wichtigsten Touchpoints der Customer Journey der Zielgruppen.
“Unglaublich mit wie viel Professionalität die Projekte erarbeitet wurden. Jede einzelne Gruppe war großartig! Ich habe selten so professionelle Präsentationen gesehen. Jede einzelne Idee und Kampagne ist direkt umsetzbar”, lobten Walter und Andreas Heindl, die Geschäftsführer der Confiserie, die Studierenden im Anschluss an die Präsentationen.
Nach einem spannenden Vormittag fiel die Wahl der zwei GewinnerInnengruppen sehr schwer. Schlussendlich machten die Teams „Donauagentur“ und „Vienna Calling“ das Rennen. In den nächsten Wochen werden die beiden GewinnerInnen-Teams ihre Produkt- und Kommunikationsvorschläge vor einem erweiterten Management-Team in der Heindl-Fabrik in Liesing erneut präsentieren, um gemeinsam über etwaige Realisierungen der Konzepte zu diskutieren.
Die Projekt-Coaches Kirstie Riedl und Lisa Leone gratulieren allen Teams zu diesem erfolgreich abgeschlossenen Praxisprojekt!
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 4. Semester |
| Auftraggeber | S IMMO AG |
 Studierende entwerfen im Auftrag der Investmentgesellschaft S IMMO AG eine Kommunikationskampagne für ein neues Aktien Spiel.
Studierende entwerfen im Auftrag der Investmentgesellschaft S IMMO AG eine Kommunikationskampagne für ein neues Aktien Spiel.
Der Auftrag für das Praxisprojekt der BachelorstudentInnen im vierten Semester kam heuer von der börsennotierten Investmentgesellschaft S IMMO AG. Im Zuge von Corporate Social Responsibility Maßnahmen der S IMMO AG wurde ein Aktien-Tippspiel entwickelt, das jungen Erwachsenen Wissen rund um die Kapital- und Aktienwelt näherbringen soll.
Die Studierenden wurden damit beauftragt, ein Kommunikationskonzept zur Vermarktung des Spiels zu entwickeln. Neben fachlichen Inputs erhielten die sechs Studierendenteams regelmäßige Coachings von ihren Lektoren. Es galt für die Studierenden die Konzepte, die Strategie sowie sämtliche kreative Maßnahmen innerhalb eines festgelegten Budgetrahmens selbst zu entwerfen und durchzuplanen. Der Auftrag bot den jungen Kommunikationstalenten die einmalige Gelegenheit, ihr Können nach vier Semestern Fachstudium unter Beweis zu stellen.
Besonders interessant war der Auftrag für die StudentInnen der FHWien der WKW, da sie selbst die Zielgruppe des Spiels darstellen. Die sogenannte Generation Y, die zwischen 1980 und 1999 geboren ist und jetzt vor wichtigen Lebensentscheidungen steht, sollte mit Fakten aus der Finanzwelt vertraut gemacht werden. „Da eine generelle Unlust besteht, sich mit finanzwirtschaftlichen Themen zu beschäftigen, haben wir die Aktien Trophy erfunden. Sie soll es ermöglichen, Financial Literacy spielerisch zu vermitteln. Die Mitspielerinnen und Mitspieler sollen mit Begeisterung an der Trophy teilnehmen, dabei etwas über Finanzthemen lernen und mit Freude zur nächsten Runden wiederkommen“, so die AuftraggeberInnen beim Briefing am Anfang des Semesters.
In dem über mehrere Wochen laufenden Spiel treten jeweils zwei börsennotierte Unternehmen gegeneinander an. Die bessere Aktien-Performance innerhalb einer Runde gewinnt. Die Spielerinnen und Spieler setzen jeweils auf ihren Favoriten. Wenn der Tipp richtig war, erhalten sie einen Punkt. Zusätzliche Punkte kann man durch die Beantwortung von Fragen bei einem Online- Quiz sammeln. Als Hauptpreis wartet eine Reise nach New York.
Wir sind stolz berichten zu dürfen, dass die Konzepte der StudentInnen bei den AuftraggeberInnen so gut angekommen sind, dass Elemente daraus tatsächlich auf der Seite der Aktien Trophy und darüber hinaus zu finden sein werden.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester |
| Auftraggeber | AccorHotels |

(c) AccorHotels
Studierende der FHWien der WKW erarbeiteten im Rahmen eines Praxisprojekts in Kooperation mit der Hotelkette AccorHotels Kommunikationsstrategien und Umsetzungsmaßnahmen, um die Präsenz der bestehenden B2B-Produkte zu verstärken.
Die entworfenen Strategien und Maßnahmen der Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft fokussierten sich darauf, die Kommunikation der B2B-Produkte “Away on Business“ und “Business Plus“ verstärkt zielgruppenorientierter zu gestalten und zu positionieren. Die Ergebnisse des Projekts wurden in den von AccorHotels zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten des Hotels am Konzerthaus präsentiert.
Ziel der insgesamt sechs Projektgruppen war es, ein Kommunikationskonzept für die B2B-Produkte “Away on Business“ und “Business Plus“ zu gestalten. Dabei sollte speziell die Zielgruppe Digital Clients der Klein- und Mittelbetriebe erreicht werden, um die Nutzung des Kundenbindungsprogramms anzukurbeln. Die Vielfalt der unterschiedlichen Ansätze ließ keine Wünsche offen. Neben dem Aufgreifen der Digitalisierung durch Apps und Chatbots überraschten die Studierenden mit ausgeklügelten Social Media Umsetzungen, Newsletter Kampagnen und vielem mehr. Die Durchführung des Praxisprojekts stellte für alle Beteiligten eine neue, tolle und vor allem lehrreiche Erfahrung dar.
Sabine Toplak, VP Sales & Distribution AccorHotels in Österreich, lobte im Anschluss der einzelnen Präsentationen die durchdachte und kreative Umsetzung des Auftrags durch die Studierenden und betonte vor allem die gute Zusammenarbeit mit der FHWien der WKW. Aufgrund der bereichernden Erfahrung und den zufriedenstellenden Ergebnissen, stellte sie die mögliche Durchführung weiterer Projekte mit der FHWien der WKW in Aussicht.
Martina Zöbl, Academic Coordinator der FHWien der WKW, blickt auf den Verlauf des Projekts zurück: „In diesem anspruchsvollen Projekt haben die Studierenden besonderen Einsatz geleistet. Sie haben Professionalität in der Kommunikation und Abstimmung mit einem Auftraggeber gezeigt und durch das genaue Hinterfragen der Zielsetzung und firmeninternen Möglichkeiten darf sich Accor nun über viele umsetzbare und innovative Ideen freuen.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester |
| Auftraggeber | OMV AG |

(c) OMV AG
Die Praxisprojekte gehören fraglos zu den intensivsten Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium Kommunikationswirtschaft an der FH der WKW. Im abgelaufenen Wintersemester ritterten die Studierenden um das beste Kommunikationskonzept zu den Sponsorings der OMV für das ÖSV Skisprung-Team und die Wiener Staatsoper.
Mit der OMV ist es der FH der WKW auch dieses Semester gelungen, einen Big-Player der Wirtschaft an Bord zu holen. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch internationale Geschäftstätigkeit, sondern auch durch gezieltes Sponsoring österreichischer Institutionen aus. Neben dem Skisprung-Team des ÖSV unterstützt die OMV daher auch Einrichtungen wie die Wiener Staatsoper oder das Konzerthaus bei der Finanzierung ihrer Arbeit.
„Energie für Österreich ist uns wichtig. Das heiß auch, dass wir außerhalb unserer unternehmerischen Tätigkeit einen Beitrag leisten und unsere gesellschaftliche Verantwortung erfüllen“, erklärt Christof Meixner, Head of Corporate Reputation der OMV, das Engagement im Sport- und Kulturbereich.
Sein Auftrag an die Studierenden: Die OMV-Sponsorings in den beiden Bereichen sollen mit einer On/offline-Kampagne deutlich erlebbarer werden. „Die Studierenden haben sich richtig reingehängt und Geschichten entwickelt, die unterschiedlich und tragfähig sind. Die eine oder andere davon würden wir gerne umsetzen“, teasert Meixner.
Erster Pitch für Studierende
„Ich finde es echt cool, dass wir unsere Ideen nicht nur einfach aufschreiben und abgeben, sondern unsere Arbeit ernsthaft präsentieren können – so wie es in der Wirtschaft üblich ist. Wir haben dabei viel gelernt“, fasst Jahrgangssprecherin Kerstin Heschl die Zusammenarbeit mit der OMV zusammen. In fünf Gruppen erarbeiteten die Studierenden ihre Kampagnenideen stellten sie abschließend vor der Bewertungsjury und dem gesamten Jahrgang vor. „Für viele von uns war das der erste echte Pitch. Das war eine spannende Erfahrung die uns allen sicher auch im Berufsleben weiterhilft“, so Heschl abschließend.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 4. Semester |
| Auftraggeber | Technisches Museum |

(c) Technisches Museum
Das Technische Museum Wien möchte ein neues Produkt mit einem kreativen Kommunikationskonzept bekannt machen und wandte sich zur Unterstützung an die StudentInnen des Studienbereichs Kommunikation, Marketing und Sales der FH Wien der WKW.
Die wichtigsten Schlagworte dabei waren Social Media und Gamification. Höhepunkt des Projekts war die Präsentation der Ergebnisse Mitte Juni im prunkvollen Festsaal des Technischen Museums Wien. Die ausgearbeiteten Strategien reichten von kreativen Onlinespielen über Video-Click-Adventure und originellen Bildkampagnen bis hin zu einer Eroberungsrallye durch Wien. Auftraggeber Hermann Tragner vom Technischen Museum war erfreut über den Ehrgeiz und das Engagement, mit dem sich die StudentInnen dem Projekt gewidmet haben: „Es ist erstaunlich, wie jede Gruppe mit unterschiedlichen Ansätze an die Aufgabe herangegangen ist. Die Vielfalt der entstandenen Ideen ist enorm. Wir als Museum nehmen sehr viel Input aus dem Projekt mit.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 4. Semester |
| Auftraggeber | AMA-Marketing GesmbH |
 Mit einer anspruchsvollen Aufgabe konfrontierte Helmut Lackner, Social Media Manager der AMA-Marketing GesmbH und Auftraggeber des Praxisprojektes, die Kommunikations-wirtschaftsstudierenden der Vollzeitvariante Mitte Februar 2016. Es sollte eine produkt-übergreifende Informationskampagne für Onlinekanäle erstellt werden. Ein spezieller Fokus sollte dabei auf die junge Zielgruppe zwischen 23 und 35 gelegt werden. In den folgenden vier Monaten analysierten die Studierenden das Unternehmen, die Branche und die Zielgruppe. Mit Input zu den Themen Lebensmittel und Budgetierung war der Jahrgang für das Projekt bestens gewappnet.
Mit einer anspruchsvollen Aufgabe konfrontierte Helmut Lackner, Social Media Manager der AMA-Marketing GesmbH und Auftraggeber des Praxisprojektes, die Kommunikations-wirtschaftsstudierenden der Vollzeitvariante Mitte Februar 2016. Es sollte eine produkt-übergreifende Informationskampagne für Onlinekanäle erstellt werden. Ein spezieller Fokus sollte dabei auf die junge Zielgruppe zwischen 23 und 35 gelegt werden. In den folgenden vier Monaten analysierten die Studierenden das Unternehmen, die Branche und die Zielgruppe. Mit Input zu den Themen Lebensmittel und Budgetierung war der Jahrgang für das Projekt bestens gewappnet.
Am 24. Mai 2016 wurden die Ergebnisse der sechs Gruppen in den Räumlichkeiten der AMA präsentiert. Unterschiedlichste Kampagnen wurden erstellt, die von 360°-Videos, über eine Food-WG bis hin zu einer AMA-Love-Story reichten. Auftraggeber Helmut Lackner zeigte sich sichtlich begeistert von der Professionalität der Konzepte und beschrieb diese als „ […] bereichernd für unsere strategische Kommunikationsplanung […]“. Die verschiedenen kreativen Ideen der Studierenden des vierten Semesters versetzten nicht nur den Auftraggeber in Staunen, sondern auch Modul-Leiterin Sieglinde Martin: „Es ist faszinierend zu sehen, wie unsere Studierenden mittels kreativem Storytelling im digitalen Umfeld die AMA Geschichte via Social Media erzählt haben. Das Engagement, mit dem in diesem Jahrgang Begeisterung erzeugt wurde, ist beeindruckend. Ich bin sicher, diese Alumni werden auch in der Praxis im Berufsfeld Erfolgsgeschichten schreiben.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester |
| Auftraggeber | The Red Bulletin |
 Im Wintersemester 2015 drehte sich alles um die Vernetzung von Print und Digital. Im Rahmen des Praxisprojekts für The Red Bulletin erarbeiteten die Studierenden des Bachelor Kommunikationswirtschaft Konzepte mit dem Ziel, langfristig die Leserschaft zu vergrößern, die Marktposition zu stärken und den Werbewert des Magazins zu erhöhen.
Im Wintersemester 2015 drehte sich alles um die Vernetzung von Print und Digital. Im Rahmen des Praxisprojekts für The Red Bulletin erarbeiteten die Studierenden des Bachelor Kommunikationswirtschaft Konzepte mit dem Ziel, langfristig die Leserschaft zu vergrößern, die Marktposition zu stärken und den Werbewert des Magazins zu erhöhen.
In Summe präsentierten die Gruppen sechs ausgeklügelte Strategien und kreative Maßnahmen, die von neuen Kooperationen über CRM-Systeme, neue Distributionswege, bis hin zu internen Umstrukturierungen und natürlich tollen Events reichten.
Belohnt wurde die harte Arbeit dann noch mit einer außergewöhnlichen Ankündigung: einer Einladung ins Red Bull Media House Publishing zur Präsentation der Ideen vor erweiterter Runde.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester (Vollzeit) |
| Auftraggeber | OMV AG |
 Die Reputationsdimensionen „technologische Kompetenz“ und „gesellschaftliche Verantwortung“ in sozialen Medien für die österreichische Bevölkerung noch stärker erlebbar zu machen, war die Herausforderung im Praxisprojekt des Wintersemesters 2014/15, die Christof Meixner, Head of Corporate Branding OMV, 30 Studierenden stellte.
Die Reputationsdimensionen „technologische Kompetenz“ und „gesellschaftliche Verantwortung“ in sozialen Medien für die österreichische Bevölkerung noch stärker erlebbar zu machen, war die Herausforderung im Praxisprojekt des Wintersemesters 2014/15, die Christof Meixner, Head of Corporate Branding OMV, 30 Studierenden stellte.
Die Kampagnen-Ideen reichten von einem H²O Wasserstoff-Quiz-Taxi mit Sciencebuster Werner Gruber als Chauffeur über einen umfassender Social-Media Auftritt mit einer „OMV-Wusstest du schon?“-Faktenseite bis hin zu innovativen Lehrmaterialien für den naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Und auch bei den Studierenden hatte das Projekt nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Maria S., eine der Studierenden: „Schon bei meiner Bewerbung an der FHWien der WKW betrachtete ich die Praxisprojekte als einen meiner Hauptgründe, warum ich unbedingt an der FH aufgenommen werden wollte. Aus diesem Projekt haben wir alle sehr viel zusätzliches Wissen mitgenommen.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester (berufsbegleitend) |
| Auftraggeber | Sky Österreich GmbH |
 Snap by Sky ist eine Online-Videothek von Sky Österreich, die sich auf einem heiß umkämpften Markt mit großer Konkurrenz konfrontiert sieht. Grund genug, um die Studierenden des Bachelorstudiengangs Kommunikationswirtschaft (2016) mit einer Konzepterstellung zu beauftragen. Ziel war es, eine Kommunikationskampagne zu entwickeln, um den Anbieter von Filmen und Serien in Österreich zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen.
Snap by Sky ist eine Online-Videothek von Sky Österreich, die sich auf einem heiß umkämpften Markt mit großer Konkurrenz konfrontiert sieht. Grund genug, um die Studierenden des Bachelorstudiengangs Kommunikationswirtschaft (2016) mit einer Konzepterstellung zu beauftragen. Ziel war es, eine Kommunikationskampagne zu entwickeln, um den Anbieter von Filmen und Serien in Österreich zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen.
Sechs Gruppen stellten im Rahmen der Abschlusspräsentation unterschiedlichste Konzepte vor, die vom Fernsehspot über Ambient Advertising bis zu Guerilla PR kreative Ideen und Maßnahmen enthielten „Wir waren überrascht über das Niveau sowie über die Ansätze und Ideen, die uns vorgelegt wurden“, zeigte sich Andreas Stöger, Director Direct Sales bei Sky Österreich überzeugt. „Besonders das out-of-the-box-Denken hat uns verblüfft“, so auch Doris Thanner, Managerin Direct Sales bei Sky Österreich.
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester (Vollzeit) |
| Auftraggeber | ÖAMTC Fahrtechnik GmbH |
 Der Jahrgang 2015 des Bachelorstudienganges Kommunikationswirtschaft hatte einen rasanten Einstieg ins dritte Semester: Die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH bot den Studierenden einen actionreichen Tag im Fahrtechnikzentrum Teesdorf. Die Angebote der ÖAMTC Fahrtechnik sollten selbst aktiv erlebt werden, um in weiterer Folge ein integriertes Kommunikationskonzept zu erstellen.
Der Jahrgang 2015 des Bachelorstudienganges Kommunikationswirtschaft hatte einen rasanten Einstieg ins dritte Semester: Die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH bot den Studierenden einen actionreichen Tag im Fahrtechnikzentrum Teesdorf. Die Angebote der ÖAMTC Fahrtechnik sollten selbst aktiv erlebt werden, um in weiterer Folge ein integriertes Kommunikationskonzept zu erstellen.
Der Auftrag, die ÖAMTC Fahrtechnik als attraktiven Anbieter des Mehrphasentrainings in den Köpfen der Jugendlichen zu verankern, wurde mit zahlreichen kreativen und unkonventionellen Maßnahmen umgesetzt. Es wurden „Schleuderbananen“ und Kondome verteilt, ganze Stadtteile in Luftpolsterfolie gehüllt und die „Mehrphasenhasen“ vorgestellt.
Auftraggeber Mag. Franz Schönbauer von der Geschäftsleitung der ÖAMTC Fahrtechnik war sehr angetan von den Ergebnissen: „Die Präsentationen, Ideen und Inhalte überstiegen unsere Erwartungen bei Weitem und wir freuen uns schon darauf, den einen oder anderen Schwerpunkt bald umzusetzen.“
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester (berufsbegleitend) |
| Auftraggeber | easyname GmbH |
![]() Bereits zum dritten Mal galt es für die berufsbegleitend Bachelor-Studierenden der Kommunikationswirtschaft ihr Können im Rahmen eines Praxisprojekts unter Beweis zu stellen und ein Konzept für einen realen Auftraggeber aus der Wirtschaft zu entwerfen. easyname, einer der führenden Domain- und Hostinganbieter Österreichs ermöglichte es den Studierenden erneut die Praxis zu studieren und den internationalen Domain-Markt etwas näher kennen zu lernen. Im Zuge des Projektauftrages setzten sich die Studierenden mit dem komplexen Geschäftsfeld auseinander und präsentierten abschließend kreative Kommunikationskonzepte zur Weiterentwicklung der Marke easyname.
Bereits zum dritten Mal galt es für die berufsbegleitend Bachelor-Studierenden der Kommunikationswirtschaft ihr Können im Rahmen eines Praxisprojekts unter Beweis zu stellen und ein Konzept für einen realen Auftraggeber aus der Wirtschaft zu entwerfen. easyname, einer der führenden Domain- und Hostinganbieter Österreichs ermöglichte es den Studierenden erneut die Praxis zu studieren und den internationalen Domain-Markt etwas näher kennen zu lernen. Im Zuge des Projektauftrages setzten sich die Studierenden mit dem komplexen Geschäftsfeld auseinander und präsentierten abschließend kreative Kommunikationskonzepte zur Weiterentwicklung der Marke easyname.
„Ich bin sehr überrascht über die Ergebnisse der einzelnen Gruppen, besonders freut es mich zu sehen, dass sich jedes Team so intensiv mit diesem doch sehr speziellen Thema und unserem Unternehmen auseinandergesetzt hat“, freute sich Florian Schicker, Geschäftsführer von easyname.
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 2. Semester (Vollzeit) |
| Auftraggeber | ERSTE Group |
 Dem Jahrgang 2015 des Bachelorstudienganges Kommunikationswirtschaft wurde im 2. Semester eine besondere Aufgabe zuteil: die Erstellung eines integrierten Kommunikationskonzeptes für das Corporate TV der Erste Group Bank AG.
Dem Jahrgang 2015 des Bachelorstudienganges Kommunikationswirtschaft wurde im 2. Semester eine besondere Aufgabe zuteil: die Erstellung eines integrierten Kommunikationskonzeptes für das Corporate TV der Erste Group Bank AG.
Neben Ideen für neuen Content standen auch Konzepte für ganze Sendeleisten ganz oben auf der Hit-Liste der Auftraggeber und so entstanden viele Vorschläge und Ausarbeitungen zu Videoportalen und Sendeformaten. Auch die interaktive Einbindung der MitarbeiterInnen der Erste Group in das CTV wurde nicht außer Acht gelassen.
„Es waren tolle Ideen dabei, ich bin wirklich positiv überrascht“, zeigte sich Maria Schleifer, Head of Group Internal Communications, begeistert über das Ergebnis. Man freue sich schon auf die nächste Zusammenarbeit mit der FHWien der WKW.
„Für mich sind alle Erwartungen erfüllt“, so Michael Hafner, Group Internal Communications. Man habe viel Material, mit dem weiter gearbeitet werden könne.
Auch die Lektorinnen lobten den Jahrgang. „Sie haben uns wirklich beeindruckt!“, meinte Sanem Keser-Halper. Bettina Gneisz-Al-Ani ortete „durch die Bank ordentliche Leistungen“.
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 2. Semester |
| Auftraggeber | FITINN |
 Bekannt für ihre offensive Werbelinie widmet sich die Fitnesskette Fitinn nun der Weiterentwicklung der Marke Fitinn und das vor allem in Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Bei den Studierenden des 2. BA-Semesters „Kommunikationswirtschaft“ (berufsbegleitend) war dieser Auftrag bestens aufgehoben. Auftraggeber Michael Stangl nach den Konzeptpräsentationen: „Ich bin begeistert von den vielen innovativen Ideen die wir gehört haben, und bin sicher, das ein oder andere wird auch in unsere Umsetzung mit einfließen.“
Bekannt für ihre offensive Werbelinie widmet sich die Fitnesskette Fitinn nun der Weiterentwicklung der Marke Fitinn und das vor allem in Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Bei den Studierenden des 2. BA-Semesters „Kommunikationswirtschaft“ (berufsbegleitend) war dieser Auftrag bestens aufgehoben. Auftraggeber Michael Stangl nach den Konzeptpräsentationen: „Ich bin begeistert von den vielen innovativen Ideen die wir gehört haben, und bin sicher, das ein oder andere wird auch in unsere Umsetzung mit einfließen.“
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester (berufsbegleitend) |
| Auftraggeber | OMV AG |
 Integrierte Kommunikationskonzepte für Zielgruppen aus den Sinus Milieus sind nicht alltäglich.
Integrierte Kommunikationskonzepte für Zielgruppen aus den Sinus Milieus sind nicht alltäglich.
Im Auftrag der OMV haben sich die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft im Wintersemester 2012 dieser Herausforderung gestellt. Das Ziel war die Entwicklung integrierter Kommunikationskonzepte und geeigneter Maßnahmen, die die Reputation der OMV als Energieversorger und Arbeitgeber in den ausgewählten Sinus Milieus fördern.
Im Rahmen eingehender Recherchen und der Auseinandersetzung mit vier ausgewählten Zielgruppen aus den Sinus Milieus (Performer, Digitale Individualisten, Postmaterielle und Etablierte) wurde deren Bezug zur OMV analysiert. Aus den Ergebnissen wurden im Anschluss durch kreative Konzepte und Maßnahmen für die Kommunikation entwickelt.
„Es wurden sehr schlüssige Konzepte – von denen vieles umsetzbar ist – in kreativen Präsentationen gezeigt“, war eine Reaktion von Egon Ostermann, Branding & Advertising – Corporate & Sustainability, seitens des Auftraggebers OMV.
„Aus der Kombination der vielen kreativen Vorschläge ist einiges machbar“ zeigte sich auch Markus Pilsl, Online/Online Management – Corporate & Sustainability, beeindruckt.
Die Lektoren zeigten sich ebenso begeistert über „die vielen verwertbaren Out-of-the-box-Lösungen“, so Ilse Stria, obwohl „es nicht auf der Hand liegt dafür Lösungen zu finden“, wie Peter Dietrich anmerkte.
| Studiengang | BA Kommunikationswirtschaft |
| Semester | 3. Semester (Vollzeit) |
| Auftraggeber | TUI ReiseCenter |
![]() Im 3. Semester angelangt, wurde der Bachelor-Studiengang „Kommunikationswirtschaft“ mit einer ganz besonderen Problematik des TUI ReiseCenter konfrontiert, denn: Wer geht im Zeitalter von Web 2.0 noch ins Reisebüro, um seinen Urlaub zu buchen?
Im 3. Semester angelangt, wurde der Bachelor-Studiengang „Kommunikationswirtschaft“ mit einer ganz besonderen Problematik des TUI ReiseCenter konfrontiert, denn: Wer geht im Zeitalter von Web 2.0 noch ins Reisebüro, um seinen Urlaub zu buchen?
Sechs spannende Konzepte wurden von den Studierenden zu diesem Thema präsentiert, die ganz genau aufzeigten, welche Vorteile das Reisebüro immer noch bieten kann. Angefangen bei kulturell bedingten AHA-Momenten im Urlaubsland über den ganz persönlichen Travelcoach für Travellisten und Skifahren am Stephansplatz gab sich eine kreative Idee nach der anderen die Hand.
Begeisterung auch bei Auftraggeber Harald Kraus: „Ich hätte gerne jede Gruppe für drei Monate bei uns im Unternehmen, die dann diese Dinge auch mit Freude und Dynamik umsetzen!“
Master-Studiengang Kommunikationsmanagement
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Auftraggeber | Wienerberger AG |
 Im Praxisprojekt des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement entwickelten die Studierenden durchdachte Strategien rund um den Launch einer App für Mitarbeiter:innen mit eingeschränktem Zugriff auf Smartphones.
Im Praxisprojekt des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement entwickelten die Studierenden durchdachte Strategien rund um den Launch einer App für Mitarbeiter:innen mit eingeschränktem Zugriff auf Smartphones.
Die Wienerberger AG kombiniert langjährige Firmentradition erfolgreich mit Innovation. Das gilt auch für die Unternehmenskommunikation. Um in der internen Kommunikation am Puls des digitalen Zeitalters zu sein, beauftragte das Unternehmen die Studierenden des berufsbegleitenden Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement der FHWien der WKW, kreative und strategische Kommunikationskonzepte für die Einführung einer internen App zu konzipieren. Diese sollten sowohl die kommunikative Begleitung der App-Einführung selbst als auch die redaktionelle Bespielung des neuen Kanals umfassen. Die besondere Herausforderung dabei war die Zielgruppe der „Blue Collar Worker“, auf die die App ausgerichtet werden soll. Diese Mitarbeiter:innengruppe besitzt nur selten ein Diensthandy und hat während der Arbeitszeit keinen Zugriff auf ihr Smartphone.
Vertrauen in die „Next Experts“
Für innovative Konzepte setzte die Auftraggeberin auf Ideen der neuen Generation von Kommunikationsexpert:innen der FHWien der WKW. In Kleingruppen entwickelten die Studierenden Konzepte, die neue Trends aus der Theorie in die Praxis überführen und gleichzeitig die starke Unternehmensphilosophie der Wienerberger AG vermitteln. Dabei wurden die Teams in Coachings von Lehrenden mit langjähriger Branchenerfahrung aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, Marktforschung, Budgetierung und Moderation begleitet.
In regelmäßigem Austausch mit den Expert:innen der Wienerberger AG finalisierten die Studierenden ihre Konzepte, die Offline- und Online-Kanäle zielgruppengerecht miteinander verbinden. So setzten sie beispielsweise auf Trendthemen wie Chatbots oder QR-Codes, während auch klassische Maßnahmen wie diverse Drucksorten nicht zu kurz kamen.
Gelungene Zusammenarbeit
„Die Zusammenarbeit mit der FHWien der WKW war wirklich sehr gut. Schon bei den Zwischenpräsentationen gab es tolle Gespräche und Zwischenfragen, wo wir noch einige Dinge nachschärfen konnten. Die Endpräsentationen waren der krönende Abschluss einer gelungenen Zusammenarbeit“, so Auftraggeberin Sarah Rebecca Keiler, Communications & Employer Brand Manager bei Wienerberger, über das gemeinsame Projekt.
Auch Hilda Helyes, Lehrende und Leiterin des Praxisprojekts, war begeistert:
„Mit Wienerberger hatten wir ein besonders spannendes Projekt, weil die Aufgabenstellung nicht einfach war. Die Studierenden haben die Umsetzung perfekt gemeistert. Bereits in den Coachings haben wir Schritt für Schritt gesehen, wie die Studierenden sich zunehmend hineingesteigert und ihr Bestes gegeben haben.“
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Auftraggeber | VGN Medien Holding |
 Weg von den Themen hin zu den Communitys lautete der Auftrag der VGN Medien Holding an die Master-Studierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement. Ziel war eine Neupositionierung am hart umkämpften Medienmarkt.
Weg von den Themen hin zu den Communitys lautete der Auftrag der VGN Medien Holding an die Master-Studierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement. Ziel war eine Neupositionierung am hart umkämpften Medienmarkt.
Im Sommersemester 2022 standen die Studierenden des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement der FHWien der WKW in ihrem zweiten Praxisprojekt vor einem sehr komplexen Auftrag. Mit der Möglichkeit sehr kreativ zu werden, entwarfen sie strategisch fundierte Kommunikationskampagnen, um die Marken trend., woman und News der VGN Medien Holding neu zu positionieren und damit näher an ihre Communitys zu bringen.
Netzwerken und Metaverse als Erfolgsfaktor
Nach dem umfangreichen Briefing starteten die Studierenden in den Marktforschungsprozess. Mittels Interviews und SWOT-Analyse arbeiteten die Teams klare Leistungsversprechen heraus, welche die Aufmerksamkeit bei der Community an sich ziehen und zu Engagement anregen sollen. Durch Visualisierung mittels geeigneter Key-Visuals unterstrichen die Studierendengruppen gekonnt die Botschaften an die Communitys. Dabei schöpften sie mit hohem Einfallsreichtum und in professioneller Weise alle Möglichkeiten der digitalen Kommunikation aus und gingen sogar einen zukunftsweisenden Schritt Richtung Metaverse weiter. Auch durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder boten die Studierenden einen umfangreichen Ideenpool, aus dem die AuftraggeberInnen nun für den optimalen Aufbau ihrer Communitys schöpfen können. Abgerundet durch ein hohes Ausmaß an Know-how in Strategie und Umsetzung, das auch Budgetierung und Erfolgskontrolle umfasste, lieferten die Master-Studierenden eine solide Leistung zur hohen Zufriedenheit der VertreterInnen der VGN Medien Holding ab.
Abschlusspräsentationen begeistern VGN Medien Holding
„Die Studierenden haben es geschafft, aus einer facettenreichen Aufgabenstellung ein strukturiertes und kreativ greifbares Gesamtkonzept abzuliefern. Das ist ihnen sehr gut gelungen. Großes Lob auch für die hohe Präsentationsqualität!“, kommentiert Geschäftsführer Michael Pirsch.
Brand Managerin Katharina Kaiser resümiert: „Es ist Einiges dabei, das wir ins Auge fassen können. Insbesondere das eine oder andere Event wird sich in der Realität wiederfinden können. Besonders spannend war die Idee zur Einbindung des Metaverse, weil dies sicher für unsere Zielgruppen etwas ganz Neues und noch nicht so Gesehenes ist.“
Auch Coach David Dobrowsky, Lehrender sowie Studiengangsleiter an der FHWien der WKW, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen:
„Am Anfang standen die Studierenden vor der Herausforderung, aus einem sehr komplexen Briefing ihre Zugangsweise herauszufiltern. Das war ein wichtiger Prozess, der das reale Business widerspiegelt. Schlussendlich entstanden sehr kreative, aufeinander abgestimmte und feinjustierte Maßnahmenpakete.“
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Auftraggeber | ratiopharm |
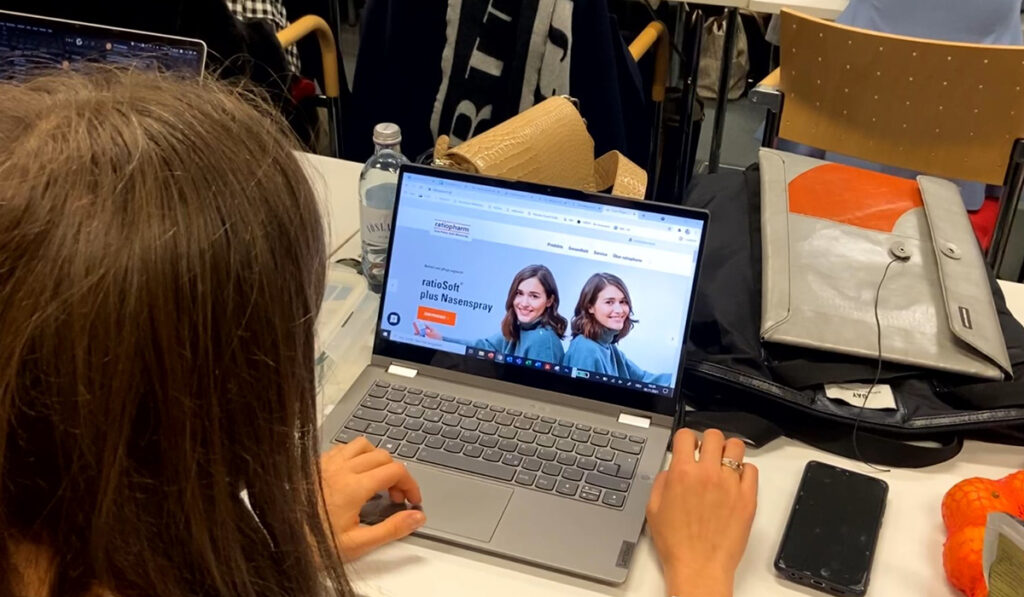 Kommunikationskonzepte für die Pole-Position am heißumkämpften Generikamarkt zu entwerfen, war der klare Auftrag von ratiopharm an die Master-Studierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement im Wintersemester 2021/22.
Kommunikationskonzepte für die Pole-Position am heißumkämpften Generikamarkt zu entwerfen, war der klare Auftrag von ratiopharm an die Master-Studierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement im Wintersemester 2021/22.
Mit einem ansehnlichen Budget ausgestattet starteten die Studierenden des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement (3. Semester) in ihr Praxisprojekt mit ratiopharm. Aufgabenstellung war die Entwicklung eines umfassenden Kommunikationskonzepts mit dem Ziel, ratiopharm, der Tochterfirma von Teva Pharmaceuticals, wieder klar als Nummer eins am österreichischen Generikamarkt zu positionieren. Als Ausgangspunkt diente eine eigens durchgeführte Marktforschungsstudie, bei der MedizinerInnen ausgewählter Fachrichtungen interviewt wurden. Die Erkenntnisse lieferten klare Ansätze für die Ziele, Strategie und Positionierung. Hier wurde insbesondere auf impactstarke Kernbotschaften gesetzt, die in konkreten On- und Offline-Maßnahmen, die von Online-Plattformen über Podcasts bis zu Weiterbildungsmaßnahmen reichten, ihre Umsetzung fanden. Ein Rahmenkonzept für die Erfolgsmessung mittels geeigneter KPIs rundete das Maßnahmenpaket in professioneller Weise ab.
Strategische Kampagnenplanung mit 360-Grad-Blickwinkel begeistert Auftraggeber
Die klar auf Strategie und integrierte Kommunikation ausgerichteten Kommunikationskonzepte begeisterten Auftraggeber Christian Graf, Sales Director Austria bei Teva Pharmaceuticals. Für die auf eine wesentliche Kernbotschaft abzielende, umfassende Kampagnenplanung und -umsetzung ernteten die Studierenden-Teams sein großes Lob:
„Ich bin begeistert von den vielen Ideen und frischen Blickwinkeln. Die Studierenden haben mit professionell und kreativ ausgearbeiteten Konzepten bei der Endpräsentation noch eins draufgesetzt. Wir werden in jedem Fall die eine oder andere Idee in unsere tägliche Praxis übernehmen können.“
Auch die Coaches Karin Lehmann, Kommunikationsexpertin und langjährige Lektorin an der FHWien der WKW sowie Georg Feldmann, Leiter des Stadt Wien geförderten Kompetenzteams für Digitalisierung der Kommunikationsprofessionen, unterstrichen die hohe Qualität der Resultate:
„Bilder sagen mehr als Worte: Wie die Marktforschung interpretiert wurde oder Podcasts und andere Ideen für Ärzte und Ärztinnen akustisch und bildhaft dargestellt wurden – das sind die großen Stärken der Präsentationen, wenn Bilder hängenbleiben.“
„Claims, Slogans – kurze, knappe, einprägsame Werbebotschaften – das sind die Erfolgsfaktoren einer Kommunikationsstrategie. Ich bin ganz begeistert, wie beim Feinschliff auf den letzten Metern ein durchwegs prägnantes, beeindruckendes Ergebnis geliefert werden konnte. Gratulation dafür!“
Die wichtigsten Eindrücke haben die Studierenden in diesem selbst erstellten Video festgehalten:
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 1. Semester |
| Auftraggeber | Klosterquell Hofer (Dreh und Trink) |
 Das österreichische Familienunternehmen Klosterquell Hofer, weltweit bekannt für das Kult-Kindergetränk „Dreh und Trink“, plant sein Produktportfolio zu erweitern. Bei der Konzeption von neuen Produktideen und deren Bewerbung setzte das Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Gutenstein auf die kreativen Fähigkeiten von Studierenden des Masterstudienganges Kommunikationsmanagement.
Das österreichische Familienunternehmen Klosterquell Hofer, weltweit bekannt für das Kult-Kindergetränk „Dreh und Trink“, plant sein Produktportfolio zu erweitern. Bei der Konzeption von neuen Produktideen und deren Bewerbung setzte das Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Gutenstein auf die kreativen Fähigkeiten von Studierenden des Masterstudienganges Kommunikationsmanagement.
Im Zuge des Praxisprojekts des Studienbereichs Kommunikation, Marketing & Sales mussten zahlreiche neue Produktideen für das Unternehmen entworfen werden. Für das zu lancierende Endprodukt, das sich in den Befragungen mit KundInnen als Sieger durchsetzte, musste ein Kommunikationskonzept entworfen werden, wobei bei der Marktkommunikation der Fokus auf „Online“ gelegt werden sollte.
Am 19. Jänner 2017 präsentierten die sechs Studierendengruppen ihre Projektergebnisse dem Auftraggeber. Klosterquell Hofer wurde u.a. repräsentiert durch Marketingleiter Mag. (FH) Michael Bauer. Nach Präsentation der Konzepte, zeigte sich Bauer begeistert von der professionellen und qualitativ hochwertigen Arbeitsleistung der Studierenden. Weiteres Lob erhielten die Studierenden auch von ihren Projektcoaches Studienbereichs-Leiterin Mag. Sieglinde Martin und Dkfm. Karin Lehmann (Markenkern), die vor allem die stufenweise Entwicklung der einzelnen Teams vom Beginn bis zum Ende des Projekts hervorhoben.
Das Praxisprojekt war auch aus Studierendensicht ein voller Erfolg: „Es freut uns wirklich sehr, dass sich Dreh und Trink für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hat. Es ist immer aufregend, einer Marke eine Stimme zu verleihen, aber sie von Anfang an begleiten zu dürfen, macht es umso spannender.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 2. Semester |
| Auftraggeber | ERSTE Group |

(c) Erste Group
Beim Master-Praxisprojekt im Sommersemester 2016 ging es um die Bespielung der Displays in den Aufzügen des neuen Erste Campus in Wien. Ein Tool, mit dem die MitarbeiterInnen informiert und gleichzeitig auch unterhalten werden können. Außerdem soll bei den über 4.500 KollegInnen, die erstmals unter einem gemeinsamen Dach zusammenarbeiten, das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden.
Die besonderen Herausforderungen dieses Projekts lagen in der sehr kurzen Verweildauer der Personen im Lift sowie in den begrenzten Möglichkeiten des relativ kleinen Displays. Der Anspruch an den Content war daher besonders hoch: in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit erregen und leicht verständliche und informative Botschaften transportieren.
Bei der Abschlusspräsentation zeigte sich Mag.a Maria Schleifer, Head of Group Internal Communications der Erste Group Bank AG von der Vielfalt und Kreativität der Konzepte beeindruckt: „Es ist faszinierend, dass man für so ein kleines Display so große Ideen haben kann. Ich bedanke mich für den Einsatz und freue mich bereits auf die nächste Zusammenarbeit.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 3. Semester |
| Auftraggeber | Österreichisches Parlament |

(c) Parlamentsdirektion / Johannes Zinner
Kooperationsprojekt des Österreichischen Parlaments und des Instituts für Kommunikation, Marketing & Sales der FHWien der WKW: Studierende der FHWien der WKW erarbeiteten in einem einzigartigen Praxisprojekt in Kooperation mit dem Österreichischen Parlament Kommunikationsstrategien und Umsetzungsmaßnahmen zur Präsenz des Parlaments im öffentlichen Raum während der Umbauphase 2017 – 2020. Die Projektergebnisse wurden in festlichem Rahmen im Empfangssaal des Hohen Hauses vor Nationalratspräsidentin Doris Bures sowie zahlreichen VertreterInnen des Parlaments und der FHWien der WKW von den Studierenden vorgestellt.
Dem Institut für Kommunikation, Marketing & Sales ist es gelungen, das Parlament für ein außergewöhnliches Praxisprojekt zu gewinnen. Studierende des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement haben Maßnahmen entworfen, um das Hohe Haus während der Umbauphase vom Sommer 2017 bis 2020 näher zu den Menschen zu bringen. Die Studierenden transformieren in ihren Konzepten den Heldenplatz zu einem einzigartigen Ort, an dem Demokratie und Parlamentarismus stattfinden. Am 16. März 2016 fand die Präsentation der einzelnen Konzepte vor Nationalratspräsidentin Doris Bures und zahlreichen Abgeordneten im Parlament statt.
Bures sprach in ihrer Rede von einer Prämiere der Kooperation zwischen einer Fachhochschule und dem Parlament und lobte die von den Studierenden entwickelten strategischen und kommunikativen Ansätze. Sie stellte weitere Projekte mit der FHWien der WKW in Aussicht. Institutsleiterin Sieglinde Martin betonte die besondere Bedeutung und Herausforderung dieses Projektes: „Wir sind uns der ehrwürdigen und einzigartigen Aufgabenstellung bewusst und stolz auf die Leistungen und Ergebnisse unserer Studierenden. Wir danken einem überaus unterstützenden Kooperationspartner und freuen uns über seine Zufriedenheit, die in Form der Einladung ins Parlament zum Ausdruck gebracht wurde.“
„Mit diesem Projekt wurde uns eine große Ehre zu Teil. Gleichzeitig haben auch unsere Studienkolleginnen und -kollegen interessante Ideen präsentiert. Deshalb verfolgen wir die Entwicklungen natürlich aktiv mit und sind auf die Umsetzung gespannt“, so Studierendensprecherin Monika Fröhlich.Die vier Projekte:
Projekt 1: Das Parlament als Gastgeber am Heldenplatz – Seien Sie unser Gast
Projekt 2: Parlament bewegen – Demokratie erleben
Projekt 3: Demokratie auf Achse
Projekt 4: Platz.Mit.Bestimmung
Alle vier Projekte sehen den Heldenplatz als Begegnungsort für Menschen. Durch etliche Maßnahmen sollen Demokratie und das Arbeiten der ParlamentarierInnen greifbar gemacht werden. Eine Kombination von interaktiven Erlebniselemente Informationselementen sowie dem Anbieten von Plattformen für Meinungsäußerung und -austausch bilden die kommunikative Basis. Insbesondere sollen durch diese Maßnahmen junge Menschen angesprochen werden, um das Parlament als moderne und bürgerInnennahe Institution zu erleben. Die Maßnahmen zur Förderung des Austausches zwischen BürgerInnen und Parlament können nach der Rückkehr ins Parlamentsgebäude 2020 weitergeführt werden.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 2. Semester |
| Auftraggeber | proPellets Austria |
 Das Praxisprojekt der Masterstudierenden Kommunikationsmanagement im 2. Semester (SoSe 2015) thematisierte die Awareness und Verbreitung von Holzpellets als umweltfreundlichem und erneuerbarem Energieträger.
Das Praxisprojekt der Masterstudierenden Kommunikationsmanagement im 2. Semester (SoSe 2015) thematisierte die Awareness und Verbreitung von Holzpellets als umweltfreundlichem und erneuerbarem Energieträger.
Die sechs Konzepte waren in Vielfalt und Herangehensweise ebenso innovativ, wie die Pelletlösungen selbst. Mit kreativen Maßnahmen wurden sowohl im Online-, als auch im Offline-Bereich die Vorbehalte der Kunden aufgegriffen und Informationen leicht verständlich vermittelt. Highlights waren unter anderem die „Pelli-Family“, Drucksorten mit Thermochromlackierung und die Nutzung von Trivago-Abrechnungen als Werbeträger.
Auftraggeber Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria, zeigte sich höchst zufrieden mit den präsentierten Ergebnissen: „Es ist erstaunlich, welche Ideen hier entstanden sind. Wir werden wahrscheinlich eine Kombination aus allem nehmen.“ Im Herbst soll mit der Umsetzung begonnen werden.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 1. Semester |
| Auftraggeber | JTI Austria |
 Quantität ist nicht gleich Qualität. Die Herausforderungen unserer Gesellschaft sind vielfältig, doch viele CSR-Projekte gleichen in ihrer Wirkung einem Tropfen auf dem heißen Stein. Die gesellschaftliche Verantwortung ist für JTI kein wirtschaftlicher Trend, sondern fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die Studierenden konzipierten Community Investment Projekte gemeinsam mit Wohltätigkeitsorganisationen und liefern das passende Kommunikationspaket.
Quantität ist nicht gleich Qualität. Die Herausforderungen unserer Gesellschaft sind vielfältig, doch viele CSR-Projekte gleichen in ihrer Wirkung einem Tropfen auf dem heißen Stein. Die gesellschaftliche Verantwortung ist für JTI kein wirtschaftlicher Trend, sondern fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die Studierenden konzipierten Community Investment Projekte gemeinsam mit Wohltätigkeitsorganisationen und liefern das passende Kommunikationspaket.
Trotz der unterschiedlichen Vorgehensweisen haben die Gruppenarbeiten eine Gemeinsamkeit: sie alle bauen Respekt zwischen JTI und der Gesellschaft auf. Die Ideen der Projektteams reichten von einem Award, bei dem soziale Vereine mit ihrer Arbeit mit Bedürftigen punkten können, über Online Plattformen für mündige Bürger bis hin zu Unterstützung von Bedürftigen im Rahmen von Social Farming. Iris Perz, Corporate Affairs & Communications Manager bei JTI Austria, war nach der Abschlusspräsentation über den strategischen Zugang und die kreative Umsetzung begeistert: „Bereits nach der Zwischenpräsentation waren wir überzeugt, den richtigen Partner für dieses Projekt gefunden zu haben. Jetzt hat sich dies noch einmal bestätigt.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 2. Semester |
| Auftraggeber | ÖAMTC Fahrtechnik GmbH |
 Die ÖAMTC Fahrtechnik sucht Neukunden für PKW-Trainings. Sechs Gruppen von Master-Studierenden erarbeiteten je eine Kommunikationskampagne, die es schafft, Sicherheit mit einem Erlebnisfaktor zu kombinieren.
Die ÖAMTC Fahrtechnik sucht Neukunden für PKW-Trainings. Sechs Gruppen von Master-Studierenden erarbeiteten je eine Kommunikationskampagne, die es schafft, Sicherheit mit einem Erlebnisfaktor zu kombinieren.
Durch die Positionierung der Trainings der ÖAMTC Fahrtechnik als alternatives Freizeitangebot mit Erlebnisfaktor, soll eine PKW-Neukundensteigerung von +10% innerhalb von zwölf Monaten erreicht werden. Den Studierenden wurde hierbei völlig freigestellt, mit welchen Botschaften und welchem Medienmix diese Ziele erreicht werden. Das Ergebnis waren verschiedene Kampagnen mit einer Gemeinsamkeit: sie stellen die Menschen und den Erlebnisfaktor in den Mittelpunkt.
Franz Schönbauer, Geschäftsleiter der ÖAMTC Fahrtechnik, lobte im Anschluss an die Präsentationen die tiefe Analyse und die kreativen Ausarbeitungen und bedankte sich für das „… sehr unterhaltsame und sehr informative Projekt und die kreativen Ansätze.“
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 1. Semester |
| Auftraggeber | ERSTE Group |
 FHWien der WKW-Studierende machen rund 46.000 MitarbeiterInnen social-media fit!
FHWien der WKW-Studierende machen rund 46.000 MitarbeiterInnen social-media fit!
Die Erste Group verfügt mit ihrem hauseigenen „Erste Open Network“ über eine moderne Intranet-Plattform. Dennoch stellte sie den Studierende des Masterstudiengangs Kommunikationsmanagement (2015) der FHWien der WKW die kritische Frage: Wie können wir unsere 46.000 Mitarbeiter in sieben Ländern zu mehr Interaktion und Engagement bei den Themen „Diversity“, „Mobiles Arbeiten“ und „Umwelt“ in unserem internen Social Media bewegen?
Sechs Gruppen nahmen die Herausforderung an und erarbeiteten völlig unterschiedliche Konzepte der Unternehmenskommunikation 2.0. Die innovativen Ideen reichten von Guerilla Marketing über einen eigens eingerichteten „Emergency Room“ bis zu zahlreichen Social Media Challenges für die MitarbeiterInnen.
„Die Strategien und Maßnahmen waren äußerst kreativ! Und zwei Konzepte würde ich sofort umsetzen“, zeigte sich Maria Schleifer, Head of Group Internal Communications Erste Group und Auftraggeberin, beeindruckt. Solch positives Feedback hören nicht nur die Studierenden der FHWien der WKW gerne.
>> Zum Projektvideo geht’s hier!
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 2. Semester (berufsbegleitend) |
| Auftraggeber | Bank Austria |
 Wie sieht die Bank der Zukunft aus? Diese Frage stellte die Bank Austria den Master-Studierenden des 2. Semester „Kommunikationsmanagement“. Sie erarbeiteten drei Zukunftsszenarien mit der Fokussierung auf „Best Case“, „Realistic Case“ und „Worst Case“. Darauf aufbauend wurden Kommunikationskonzepte, die die KundInnen und MitarbeiterInnen im Hier und Jetzt abholen und kommunikativ zum prognostizierten Szenario begleiten, erstellt. „Ich bedanke mich bei allen Studierenden für ihr Engagement“, honorierte Peter Drobil, Head of Communications der Bank Austria, die Leistungen. Das LektorInnen-Team, Maria Schreiber und Peter Dietrich, schloss das Praxisprojekt mit den Worten „Vielen Dank – der Auftrag wurde erfüllt!“, ab.
Wie sieht die Bank der Zukunft aus? Diese Frage stellte die Bank Austria den Master-Studierenden des 2. Semester „Kommunikationsmanagement“. Sie erarbeiteten drei Zukunftsszenarien mit der Fokussierung auf „Best Case“, „Realistic Case“ und „Worst Case“. Darauf aufbauend wurden Kommunikationskonzepte, die die KundInnen und MitarbeiterInnen im Hier und Jetzt abholen und kommunikativ zum prognostizierten Szenario begleiten, erstellt. „Ich bedanke mich bei allen Studierenden für ihr Engagement“, honorierte Peter Drobil, Head of Communications der Bank Austria, die Leistungen. Das LektorInnen-Team, Maria Schreiber und Peter Dietrich, schloss das Praxisprojekt mit den Worten „Vielen Dank – der Auftrag wurde erfüllt!“, ab.
| Studiengang | MA Kommunikationsmanagement |
| Semester | 3. Semester |
| Auftraggeber | A1 Telekom Austria AG |
 Studierende des Masterstudiengangs „Kommunikationsmanagement“ entwickelten für Österreichs größten Mobilfunkanbieter A1 Konzepte für Smartphone-Applikationen, mit deren Einsatz ein Beitrag zur Verbesserung der Netzqualität erreicht werden soll.
Studierende des Masterstudiengangs „Kommunikationsmanagement“ entwickelten für Österreichs größten Mobilfunkanbieter A1 Konzepte für Smartphone-Applikationen, mit deren Einsatz ein Beitrag zur Verbesserung der Netzqualität erreicht werden soll.
Mit Hilfe möglichst vieler Handy-User die Netzqualität zu verbessern – so lautete der Auftrag von A1 Operation, mit dessen Umsetzung die Studierenden des Masterstudiengangs Kommunikationsmanagement der FHWien der WKW im Wintersemester 2012/13 betraut wurden. Kern der entwickelten Konzepte war das Prinzip des Crowdsourcing, was bedeutet, dass möglichst viele Freiwillige gemeinsam an der Entwicklung oder Verbesserung eines Produkts bzw. einer Dienstleistung arbeiten. Neben dem Ziel, möglichst viele Handyuser zum Mitmachen zu motivieren, sollte auch die Smartphone-Applikation, mit deren Hilfe langfristig und kontinuierlich die Netzqualität verbessert wird von den Studierenden entwickelt werden – eine besondere Herausforderung für die angehenden Kommunikationsprofis.
International
ArbeitgeberInnen legen neben einer fachlich fundierten Ausbildung immer mehr Wert auf internationale Erfahrungen und interkulturelle Kompetenzen wie die Fähigkeit, in internationalen Teams zu arbeiten oder mit kulturellen Unterschieden adäquat umgehen zu können. Der Studienbereich Communication Management trägt dieser Entwicklung Rechnung und ist in der internationalen Community etabliert. Mit Hilfe unseres großen internationalen Netzwerks bieten wir unseren Studierenden beispielsweise:
- Einblicke in internationale Trends durch die regelmäßige Integration internationaler Gastlehrender in unsere Lehrveranstaltungen
- Auslandssemester an einer unserer 150 Partnerhochschulen weltweit: Wir haben eine große Auswahl an Erasmus-Partnern, aber auch bilaterale Abkommen und bieten Unterstützung und Beratung für diejenigen Studierenden, die lieber als „Freemover“ ins Ausland gehen möchten.
- Als edcom member school bieten wir unseren Studierenden die Teilnahme an folgenden Wettbewerben und Projekten:
- edcom Graduation Competition: Die besten Bachelor- und Masterarbeiten des Jahres werden von uns nominiert und an Inspire! by eaca (European Association of Communications Agencies) weitergeleitet.
- Ad Venture Student Competition: In diesem internationalen Wettbewerb kreieren Studierende eigene Werbekampagnen für eine(n) reale(n) AuftraggeberIn.
- Internationale Praxisprojekte: Jährlich nominieren wir ausgewählte Studierende, die an einem internationalen Praxisprojekt in Kooperation mit fünf weiteren Hochschulen teilnehmen.
- Collaborative Online International Learning (COIL)-Projekte mit unseren Partnerhochschulen in verschiedenen Modulen
- u. v. m.
News & Events
Team

FH-Prof.in Mag.a Dr.in Sieglinde Martin
Department of Communication
Head of Communication Management Study Programs
Publications


Mag. Andreas Hess, MBM

Mag.a Gisela Reiter

Dr.in Melanie Dejnega
Lecturer

Dr.in Simone Zwickl
Strategic Communication Management

FH-Prof. Dr. phil. Mag. phil. Marian Adolf

Mag.a Melanie Gratzer
Academic Expert & Lecturer
Business Administration & Law in Communication
Business Field Projects / Internships

Dr.in Evelyn Fränzl MA MDes
Research Skills & Methods

Dr.in Leyla Tavernaro-Haidarian, MA
Academic Expert & Lecturer Corporate Communication
International Coordinator













